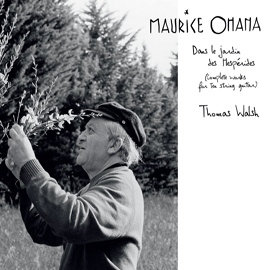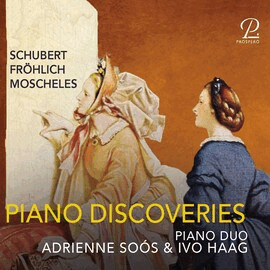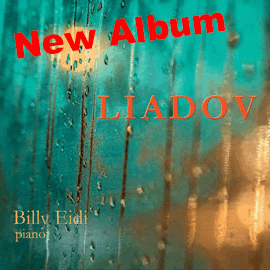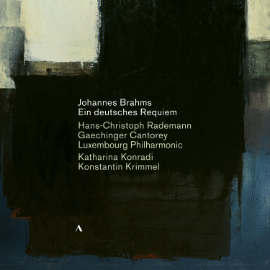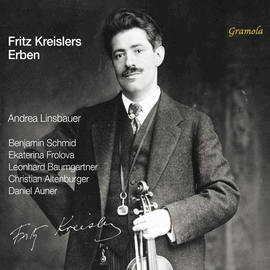Im Goldenen Saal des Musikvereins Wien war das Boston Symphony Orchestra zu Gast. Sein Chef Andris Nelsons leitete durch den Abend mit einem Shostakovich-Programm. Geigerin Baiba Skride interpretierte das 1. Violinkonzert, bevor Orchester und Dirigent sich der rund einstündigen 11. Symphonie widmeten. Uwe Krusch verfolgte für Pizzicato den Auftritt.
Vor ihrem Konzert beim Shostakovich-Festival in Leipzig anlässlich des 50. Todestages des Komponisten zeigten die Interpreten, dass sie sich schon in Höchstform befanden und dem Ambiente entsprechend ihre Kräfte sorgfältig einzusetzen wussten.
Das am Anfang des Violinkonzertes stehende Nocturne entfaltete in seiner Langsamkeit eine düster träumerische Stimmung, die mitunter sogar ins Bedrohliche umschwenkte. Es bedurfte einer eloquent und zupackend agierenden Solistin wie Baiba Skride, damit so ein Einstieg die Zustimmung des Auditoriums finden konnte. Skride nutzte alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, technische wie auch interpretatorische, um diesem abweisenden Beginn des Werkes eine die Konzentration des Publikums aufsaugende Aufmerksamkeit zuzuweisen. Eloquent und substanzreich bewältigte sie nach dem schwermütigen Anfang technisch brillant das anspruchsvolle Scherzo, das man wie einen Ausbruch des zuvor nur drohenden Tons hören mochte. Die Lettin verkörperte mit ihrem Spiel das gequälte Individuum, mal sarkastisch und tragisch, dann auch wütend oder einfach nur nachdenklich. Auch die Passacaglia, Herzstück des Werkes, zeigte sie mit emotionaler Wucht. Diese wurde verstärkt durch die nahtlose Überleitung durch die lange Kadenz, die aus der Passacaglia erwuchs und in die beendede Burleske überleitete.
Der enthusiastische Applaus für die Darbietung mündete in einer Zugabe von Baiba Skride, nämlich der Sonate Nr. 3 – Imitatione delle Campane von Johann Paul von Westhoff. Damit zeigte sie einmal mehr, wie zeitgenössisch auch alte Musik klingen kann und zu verzaubern vermag.
Unter Leitung ihres Landsmanns Andris Nelsons hatte das Boston Symphony Orchestra mit einem rhetorischen und aussagekräftigen Klanggespinst das Spiel der Geigerin begleitet.
Erstaunlich war, dass heutzutage immer noch Hörgeräte im Publikum Verwendung finden, die übersteuern und dann total nervende fiepende Dauergeräusche absondern, die die Träger dieser an sich wertvollen Hilfsmittel wohl selber nicht bemerken und deshalb auch nichts daran ändern. Auffällig waren in diesem Konzert auch zwei Wackeldackel, also Besucher die so engagiert mit heftigen Körperbewegungen und im Falle eines ganz in grau gekleideten Herren auch mit Handzeichen an seine Begleiterin die ablenkende Aufmerksamkeit von der Bühne auf sich selbst fokussierten. Eine intensive Begleitung des Gehörten in allen Ehren, aber so ein Gehampel war dann doch unangemessen.
Nach der Pause blieben Nelsons und die Bostoner bei Shostakovich. Mit der 11. Symphonie zeigten sie ein Werk, das wie auch seine 12. Symphonie, in ihrer Entstehungszeit vom System als würdige Beispiele für den sowjetischen Realismus gefeiert wurden. Dementsprechend nahm der im Kalten Krieg befangene Westen diese beiden Werke als langatmig, wenn nicht gar musikalisch zwecklos auf. Dabei begründet die leitmotivische Strukturierung dieser Symphonie eine Sonderstellung im Schaffen Shostakovichs.
Das atmosphärisch dichte Adagio des Kopfsatzes, die fahle Winterfrühe des Schlossplatzes spiegelnd, wurde von den Interpreten zwar mit aller orchestralen Präsenz und technischen Delikatesse dargereicht, entfaltete sich aber eher als ein Nachtstück, ohne nachdrücklich von der Spannung zu berichten, die in der geschilderten Situation angelegt ist.
Dem Aufstand im Zarenreich entspricht die Steigerung der Musik im zweiten Satz, die das symphonische Geschehen zu offenem Aufruhr und Massaker ausbreitete. Bei aller Gestaltungsqualität war diese existentielle Lage aus der Interpretation nicht so deutlich herauszuhören. Das haben andere, die wie Jansons, die das diktatorische sowjetische System noch selber erlebt haben, deutlicher herausgemeißelt.
Im dritten Satz fanden Nelsons und sein amerikanisches Orchester, dessen Music Director er ist, zu einem gesanglichen und nachdenklichen Ton, der dem Ewigen Andenken eine überzeugende Charakterisierung verlieh.
Der vierte Satz, der mit mehr als zweihundert Seiten der Partitur fast die Hälfte des Stückes ausmacht, entfachte die Pracht und Herrlichkeit famosen orchestralen Auftritts. Mit einem aus der eigenen Selbstgewissheit heraus virtuosen Musizieren zeigten die Musiker auf der voll besetzten Bühne, wie herrlich sie gestalten und darstellen können.
Der enthusiastisch aufbrausende Applaus des Auditoriums war ihnen sicher, so dass sie, nachdem Nelsons etliche Male auf die Bühne zurückgekehrt war, von sich aus mit dem Abtreten von der Bühne den Schlusspunkt setzen mussten.