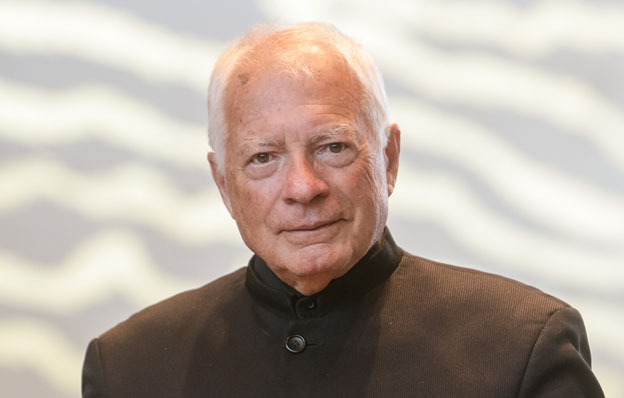Herr Hager, Sie dirigierten letzte Woche bei ihrem Konzert mit dem Luxemburg Philharmonic das exakt gleiche Programm, mit dem Sie vor fast 50 Jahren beim damaligen RTL-Symphonieorchester debütiert hatten.
Ja, 1974 kam ich zum ersten Mal nach Luxemburg. Ich wurde über meine Agentur eingeladen, das damalige RTL-Orchester zu dirigieren und zwar mit Mozarts Symphonie Nr. 40 und der Neunten von Schubert. Damals haben wir in der Villa Louvigny gespielt. Ihr Kollege Loll Weber hat mich damals sehr gelobt, nur mit dem 1. Satz der Schubert-Symphonie war er nicht einverstanden. Ich habe noch gestern mit ihm telefoniert und gesagt, er müsse zum diesem Konzert kommen, damit er seine Meinung über den 1. Satz revidiert. (lacht) Ich freue mich jetzt auch richtig, dieses Konzert in der wunderbaren Philharmonie zu machen; vor allem das Grand Théâtre der Stadt Luxemburg war ja eine akustische Katastrophe und die Villa Louvigny hatte auch ihre Grenzen.
Ein Zufall, dass Sie gerne Mozarts g-Moll Symphonie mit der großen C-Dur Symphonie von Schubert kombinieren?
Nein. Ich finde, dass das letzte Drittel der Mozart-Symphonie schon deutlich auf die Romantik hinweist und somit bereits Schubert vorwegnimmt.
In dem Sinne ist Schubert für Sie ein Romantiker und kein Klassiker?
Also, gerade bei den beiden letzten Schubert-Symphonien gibt es zwei große Interpretationslinien. Eine die von Furtwängler herkommt und sehr romantisch und klanggewaltig ist, und eine, die eher die klassische Formen mit einem kleiner besetzten Orchester vorzieht. Und Schubert somit schlanker macht. Beides geht, man muss aber wissen, dass Schubert selbst gerne ein bisschen mehr Beethoven gewesen wäre. Das hört man auch sehr deutlich in der Neunten heraus. Trotzdem, man kann Schuberts 9. Symphonie so oder so machen. Und das beginnt bereits mit dem Hornmotiv ganz am Anfang, man kann es klangprächtig und majestätisch spielen, oder eher zurückhaltend und scheu, wie aus dem Hintergrund. Wenn ich diese Symphonie dirigiere sage ich immer zu den Musikern: « Bitte spielten Sie nicht Beethoven.“
Und wie halten Sie es mit den Wiederholungen?
Es ist so: Man muss es abhängig machen von den Themen und wie oft sie kommen. Wenn Sie zu oft kommen, ergeben Wiederholungen keinen Sinn. Die Komponisten von damals haben diese Reprisen ja nur gemacht, weil keiner die Musik kannte und sich das Publikum so diese Themen besser merken konnte. Damals ergab das einen Sinn. Heute, wo man diese Werke in- und auswendig kennt, kann man auf die Wiederholungen verzichten, zumal wenn sie hundertprozentig identisch ist. Im 1. Satz lasse ich die Wiederholung weg, im 3. Satz mache ich die Wiederholung vor dem Trio nicht, ja und im 2. und 4. Satz stellt sich die Frage nicht.
Die Mozart-Symphonie machen Sie mit den Klarinetten anstatt den Oboen.
Mozart hat die Klarinette als neues Instrument erst später entdeckt. Und sie gefiel ihm hier besser als die viel hellere Oboe. Ein Zeichen dafür, dass Mozart sehr an Neuerungen interessiert war und heute ganz bestimmt auf neue, gute Instrumente und einen richtigen Flügel zurückgegriffen hätte. Der dunklere Klang der Klarinette passt auch viel besser zur Musik und wahrscheinlich war es auch dieser Klang, der Mozart vorschwebte.
Können Sie sich noch an Ihr erstes RTL-Konzert erinnern?
Oh ja, sehr gut. Aber ich muss auch sagen, das Orchester selbst hat keinen großen Eindruck auf mich gemacht. Aber die Musiker sind alle sehr gut mitgegangen und es bestand eine sehr herzliche Atmosphäre, in der ich mich sehr wohlgefühlt habe. Ich kam 1977 wieder und dirigierte die Eroica von Beethoven. Nach diesem Konzert hat man sich plötzlich für mich interessiert und angefragt, on ich mir vorstellen könnte, als neuer Chefdirigent nach Luxemburg zu kommen. Ja, und dann wurde ich 1981 Chefdirigent beim Symphonieorchester von RTL.
Was hat Sie denn damals bewogen, diesen Posten anzunehmen? Das Orchester gehörte ja nicht, wie Sie selbst sagen, zu den europäischen Spitzenensembles.
Ich bin damals mit der Erwartung nach Luxemburg gekommen, um etwas Neues auszuprobieren. Es hört sich jetzt ganz schrecklich an, aber ich wollte damals weg von Mozart und der Wiener Klassik. Ich hatte in den vorherigen Jahren so viel Mozart dirigiert, dass er fast zu Routine wurde. Und ich merkte, dass ich eine gesunde Distanz zu seiner Musik brauchte. Ich war damals ein sehr großer Freund vom Impressionismus und den beherrschte das Orchester durch Louis de Froments Arbeit hervorragend. Wir machten also einen Deal. Sie brachten mir etwas über die Spielkultur der impressionistischen Musik bei und ich führte sie in die Welt von Mendelssohn, Schumann und Bruckner ein. Denn zu diesem Repertoire hatte das damalige RTL-Orchester kaum einen Bezug.
Sie galten und gelten noch immer als Mozart-Spezialist der alten Schule. Hat sich Ihre Sichtweise in all diesen Jahren wesentlich verändert?
In den Siebzigerjahren war die Welt der klassischen Musik noch in Ordnung. Dann kamen in den Achtziger- und Neunzigerjahren Harnoncourt und seine Jünger und haben uns kräftig in die Suppe gespuckt. (lacht) Mein Ruf als Mozart-Dirigent kommt noch aus der österreichischen Tradition und ich bin auch nie den Weg der historisch informierten Aufführungspraxis mitgegangen. Es hat mir wehgetan, dass Medien und Schallplattenindustrie plötzlich die historische Aufführungspraxis als ‘die’ Revolution in der Musik betrachteten, sie zum Mainstream, zum einzig Wahren erhoben und unsere, sagen wir traditionelle Interpretationsweise aus dem Spiel nehmen wollten. Natürlich haben Harnoncourt und andere eine Pionierarbeit geleistet und neue Erkenntnisse gewonnen. Trotzdem glaube ich nicht, dass die historisch informierte Aufführungspraxis als Ideal angesehen werden soll. Hätte Mozart bessere Instrumente gehabt, glauben Sie mir, er hätte sie genutzt.
Wie sind Sie damit umgegangen, sozusagen zum ‘alten Eisen’ zu gehören?
Ich habe Mozart eigentlich dann nur noch mit den Orchestern gemacht, die sich dieser Aufführungstradition auch verpflichtet fühlten. Und ich habe viel weniger Mozart dirigiert, einfach weil ‘mein’ Mozart nicht mehr in die Zeit der Neunzigerjahre passte. Und habe mich mit viel Freude anderen Komponisten zugewandt, Dvorak, Bruckner, Mahler und immer wieder Schubert.
Sie kommen ja nun seit einigen Jahren regelmäßig zum Luxemburg Philharmonic und sind auch zum Ehrendirigenten ernannt worden. Was hat sich in diesem halben Jahrhundert verändert?
Wie gesagt, damals gab keinen richtigen Konzertsaal; in den Achtzigerjahren, als ich Chefdirigent war, probten wir in der Villa Louvigny und spielten im Grand Théâtre, später dann auch im Konservatorium, das über eine hervorragende Akustik verfügte, dessen Saal aber leider etwas klein war. Es gab kein Kammerorchester oder sonst ein nennenswertes Ensemble für klassische Musik, es gab kaum Gastkonzerte von renommierten Symphonieorchestern, es gab nur das RTL-Orchester, das alle last auf seinen Schultern tragen musste. Und auch im Publikum gab es keine richtige Tradition, wie man sie aus den großen europäischen Städten her kennt. Die Leute waren mit wenig zufrieden, weil sie keine Vergleichsmöglichkeiten hatten. Betrachtet man diesen Hintergrund und sieht, wo Luxemburg musikalisch heute steht, so sieht man, dass sich insbesondere in den letzten 25 Jahren enorm viel getan hat. Luxemburg steht auf der Landkarte der europäischen Musikszene und auch das Orchester ist zu einem Spitzenensemble geworden. Fakt ist aber auch, dass die Zahl der Musiker beachtlich gewachsen ist und dass sich das Orchester jetzt auch den Werken von Strauss, Mahler und Bruckner mühelos nähern kann. Vor ein paar Jahren habe ich hier die 6. Symphonie von Bruckner dirigiert und das Orchester war phantastisch.