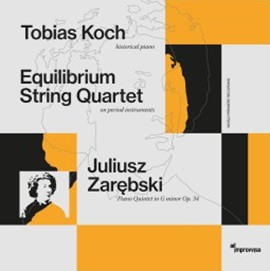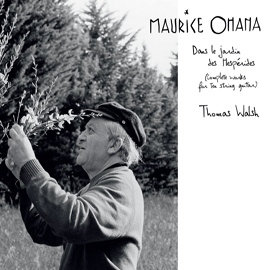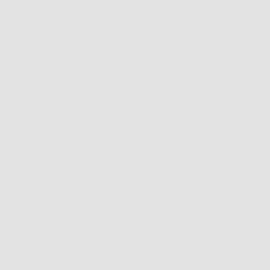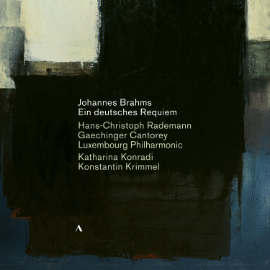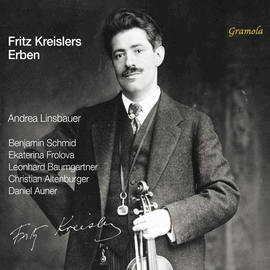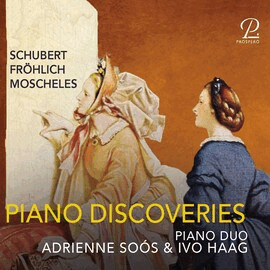Vor 50 Jahren, am 9. August 1975 verstarb in Moskau der russische Komponist Dmitri Shostakovich. Das Gewandhaus Leipzig nimmt das Datum zum Anlass eines großen Festivals. Michael Oehme berichtet.
Im Bach-Jahr 1950 war Dmitri Shostakovich das erste Mal in Leipzig. Der Komponist nahm als Juror am ersten Bachwettbewerb teil, den damals Tatjana Nikolajewa gewonnen hatte. Bachs Musik war für Shostakovich auch Anlass für seine eigenen 24 Präludien und Fugen für Klavier. Ebenfalls in Leipzig gab es zwischen 1976 und 1978 den weltweit ersten Shostakovich- Zyklus. Mit dem Gewandhausorchester führte Kurt Masur über zwei Spielzeiten hinweg kombiniert mit den Sinfonien Ludwig van Beethovens sämtliche Sinfonien des Komponisten auf. Nun feiert Leipzig über zwei Wochen hinweg mit über 30 Konzerten und Veranstaltungen erneut diesen Komponisten. In die sinfonischen Werke teilen sich das Gewandhausorchester unter Andris Nelsons, das Boston Symphony Orchestra, dessen Chefdirigent ebenfalls Nelsons ist sowie ein Festival-Orchester, während sämtliche Streichquartette vom gerühmten Quatour Danel interpretiert werden.
Den Auftakt machten Nelsons und das Gewandhausorchester mit der Festlichen Ouvertüre op. 96, einem kurzen vorder- und hintergründig schmissigem Stück Musik, das Shostakovich den Oberen seiner Zeit quasi vor die Füße geworfen hatte. Dann das 1957 von seinem Sohn Maxim uraufgeführte zweite Klavierkonzert, in Leipzig gespielt von Daniil Trifonow, der mehrfach im Festival vertreten ist. Bewundernswert, wie dieser eigentliche Klavierlöwe sein Spiel in den Dienst des Werkes stellte und mit fast mozartischer Leichtigkeit und Schönheit die Musik zum Klingen brachte. Jubel allenthalben und als Zugabe Shostakovichs Scherzo op. 1, eine virtuose Studienarbeit noch ganz im Geiste der russischen Klavierschule. Mutig schließlich, die vierte und vielleicht schwierigste aller Shostakovich-Sinfonien in das Programm des Eröffnungskonzert des Festivals zu nehmen. Shostakovich soll sie aus Sicherheitsgründen wohl selbst zurückbehalten haben. 1935 komponiert, gelangte sie erst 1961 unter Kyrill Kondraschin in Moskau zur Uraufführung. Schon zwei Jahre später brachte sie ebenfalls Kondraschin mit der Staatskapelle Dresden zur deutschen Erstaufführung. Unabhängig von allen politischen Deutungen ist sie ein Werk über das Scheitern. Die Musik erlöscht bereits am Ende des zweiten Satzes und quält sich durch das ausgiebige Largo-Moderato, natürlich grandios gespielt und disponiert von Nelsons durch das Gewandhausorchester. Das Festspielpublikum im bis auf den letzten Platz besetzten Gewandhaus konnte sich dem ohnehin nicht entziehen.
Wie befreiend dann ein Nachmittagskonzert mit Film-, Ballett- und Bühnenmusiken des Alleskönners Shostakovich. Unter der Leitung seines Impresarios und Primarius Albrecht Winter spiele das aus Gewandhausmusikern bestehende exzellente Salonorchester Cappuccino. Wie erfrischend die Parodien à la Offenbach in „Die Hornisse“ op. 97. Auch ein Agitprop-Song „Für den Frieden der Welt“ machte nachdenklich und durfte nicht fehlen. Die intelligente Moderation von Albrecht Winter verdeutlichte, was es für Shostakovich hieß, unter Angst zu komponieren.
Am zweiten Abend schließlich das erste Konzert mit dem Boston Symphony Orchestra. In einer Zeit, wo Orchestergastspiele, zumal amerikanischer seltener geworden sind, bedeutet eine solche Residenz in Leipzig schon etwas Besonderes. Entsprechend hochgespannt und prickelnd war die Stimmung im Gewandhaus. Doch zunächst stand völlig zu Recht Baiba Skride absolut im Mittelpunkt. Wunderbar absolvierte sie den Solopart im ersten Violinkonzert a-Moll, mit schönstem Ton in den innerlichen Passagen und atemberaubend virtuos in der abschließenden Burleske. Der Jubel für die lettische Geigerin wollte kein Ende nehmen.
Hauptwerk dann die über einstündige (warum so selten gespielte?) 11. Sinfonie Shostakovichs mit dem Untertitel „Das Jahr 1905“. Das sich auf den Blutsonntag dieses Jahres, der Zerschlagung des Volksaufstandes in St. Petersburg beziehende Werk ist reinste Programmmusik im besten Sinne und – hörbar – nicht nur auf dieses historische Datum, sondern auf Shostakovichs Gegenwart bezogen, gespenstig, brutal und majestätisch in der Tonsprache. Die Qualitäten der Bostoner waren in allen Gruppen zu vernehmen – äußerst markantes, glanzvolles Blech, allein die gedämpften Trompeten, ein herrliches Englischhorn, ein warmer, intensiver, aber nie scharfer Streicherklang. Dass ein Solopauker so frenetisch vom aufgestandenen Publikum bejubelt wird, habe ich so noch nicht erlebt.