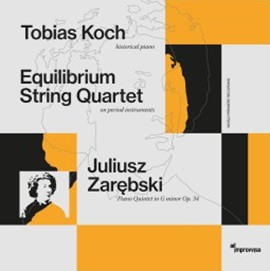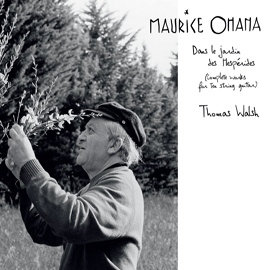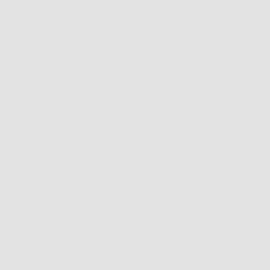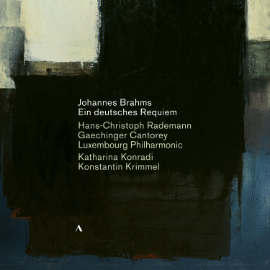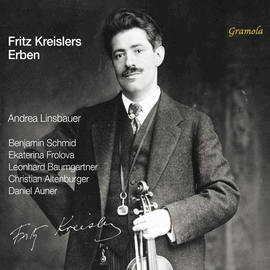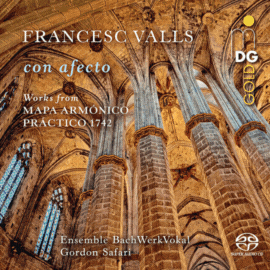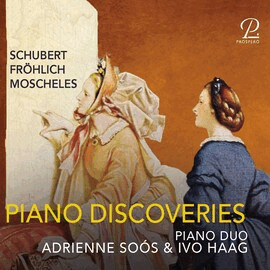Der französische Rechnungshof (Cour des Comptes) hat die Situation der französischen Opernhäuser untersucht. Die Opernhäuser seien nach wie vor von ihrer Geschichte geprägt, der Geschichte der Zentralgewalt und der Geschichte des kulturellen Ausstrahlungswillens der Städte, heißt es. Neben der Region Paris, in der sich sechs Häuser, darunter die Opéra national de Paris, konzentrieren, sind sie in den städtischen Metropolen angesiedelt.
So sind die Kommunen oder deren Zusammenschlüsse nach wie vor in der überwiegenden Mehrheit die Betreiber der Häuser, wobei der Status des Regiebetriebs die vorherrschende Form bleibt. Die Kommunen und Gemeindeverbände sind auch die wichtigsten Finanziers der Opernhäuser, sowohl durch Haushaltsmittel oder bewilligte Subventionen, die die Hälfte bis fast die Gesamtheit der öffentlichen Finanzierung ausmachen, als auch durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten und manchmal auch von Personal.
Die Unterschiede zwischen den Verwaltungsmethoden und den künstlerischen Komponenten der Häuser erschweren Vergleiche, aber alle Häuser seien mit steigenden Kosten konfrontiert, stellen die Rechnungsprüfer fest, vor allem mit der Lohnsumme und den Energiekosten, die nach der Gesundheitskrise in einem inflationären Umfeld stark angestiegen sind.
Als Folge sei das Programm häufig gekürzt worden und die Erosion der künstlerischen Marge, die das verfügbare Budget nach Übernahme der Betriebskosten misst, beeinträchtige die kreative Kapazität. Opernaufführungen, deren Produktion am kostenintensivsten ist, sind, dem Bericht zufolge, häufig als erste von Streichungsmaßnahmen betroffen. Das habe auch zu mehr Koproduktionen geführt, um Kosten zu senken.
Das französische Kulturministerium unterstützt die Opernhäuser finanziell im Rahmen einer Labeling- und Appellationspolitik, die durch die Unterzeichnung mehrjähriger Vereinbarungen mit den Einrichtungen und ihren Finanziers umgesetzt wird. Diese Vereinbarungen garantieren den betreffenden Einrichtungen ein langfristiges Ressourcenniveau, das es ihnen ermöglicht, ihr künstlerisches Projekt umzusetzen. Die Verträge stellen außerdem eine konkrete Umsetzung der nationalen Politik des Ministeriums dar.
Der weitaus größte Teil der staatlichen Finanzierung wird der Opéra national de Paris zugewiesen, deren Trägerschaft der Staat innehat. Die Art und Weise, wie die den anderen Häusern zugewiesenen Zuschüsse berechnet werden, bleibe jedoch unklar und stehe nicht im Einklang mit den Verpflichtungen, die sich aus den verschiedenen Labels und Bezeichnungen ergeben. Darüber hinaus verfügen einige Häuser, obwohl sie vom Staat finanziert werden, über keine Vereinbarung. Die Überwachung der Vereinbarungen sei nicht immer gewährleistet und anhand der Indikatoren lasse sich nur schwer überprüfen, ob die festgelegten Ziele erreicht wurden.
Zu den festgestellten Hemmnissen für eine Weiterentwicklung gehört dem Bericht zufolge, das Fehlen ausreichender Kenntnisse über das Publikum. Diese sei uneinheitlich und oft lückenhaft.
Eine weitere Schwierigkeit liege in der Art und Weise, wie die Häuser verwaltet werden. Die vorherrschende Form der Verwaltung in Eigenregie entspreche nicht mehr den Erfordernissen einer effizienteren und transparenteren Verwaltung, die es ermöglicht, alle Geldgeber an der Umsetzung eines künstlerischen Projekts zu beteiligen.
Der Hof empfiehlt den Häusern, so schnell wie möglich die Kenntnisse über das Publikum verbessern, eine regelmäßige Überwachung durch externe Erhebungen sicherstellen und diese Kenntnisse nutzen, um eine angemessene Preispolitik und eine Strategie zur Steigerung der Attraktivität zu entwickeln. Als sehr wichtig wird auch eine bessre Zusammenarbeit mit dem Ministerium empfohlen, um Überwachung und Finanzierung zu optimieren.