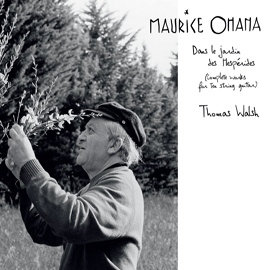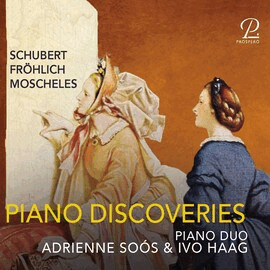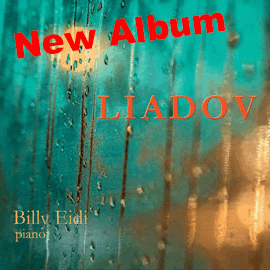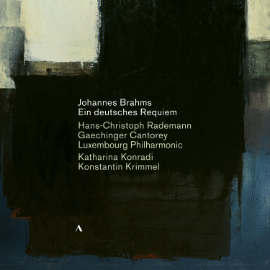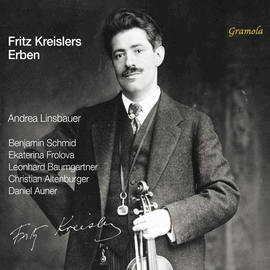Meine Begegnung mit Eva Resch war ganz wunderbar. Die Zeit verging wie im Fluge, so anregend und informativ war die Unterhaltung. Kurzum: Eva hat mich begeistert. Wenn ich diese außergewöhnliche Künstlerin in drei Worten umschreiben sollte, dann wählte ich die Worte: klug-mutig-authentisch.
Du bist ein Allround-Talent: jonglierst auf der Bühne mit schrägen und geraden Tönen, mit lauten und leisen Worten, mit Leib und Seele. Was antwortest du, wenn man dich nach deinem Beruf fragt?
Darüber muss ich erstmal nachdenken. Als erstes würde ich tatsächlich antworten: ich bin Sängerin und Gesangspädagogin. Das sind meine zwei Standbeine. Aber wenn ich wirklich schaue, was ich den ganzen Tag mache, dann bin ich eher eine eierlegende Wollmilchsau. Als Sängerin überlege ich mir viele Projekte selber, um meiner Kreativität und meinem Herzen und meinen Gedanken Ausdruck zu verleihen. Ich empfinde diesen künstlerischen Beruf als sehr ganzheitlich. Zur Projektarbeit gehört aber auch ganz viel Organisation: ich muss den Laden zusammenzuhalten, Mitwirkende gewinnen, Akquise betreiben, Partner finden, mit Veranstaltern kommunizieren. Als Lehrerin und Gesangspädagogin kommt noch ganz viel Beziehungsarbeit dazu. Da stehe ich ja weniger als Künstlerin im Fokus, sondern ich bin da, um anderen Raum zu geben. Ich höre zu, reflektiere und überlege, was ich tun kann, damit sich jemand wirklich voll ausdrücken und entfalten kann.
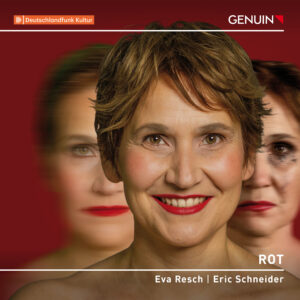 Wie bist du zum Singen gekommen bzw. zur Stimme?
Wie bist du zum Singen gekommen bzw. zur Stimme?
Mein erstes Instrument war das Klavier. Es war mein Hauptinstrument bis zum Abitur. Aber gesungen habe ich eigentlich schon immer. Bei uns zuhause wurde viel gesungen. Ich habe mich auch gern selber begleitet auf dem Klavier, habe im Chor gesungen, schon seit der Grundschule und auch solistisch im Kinderchor. Ich war auch auf einem musischen Gymnasium, d.h. Singen und Stimme waren immer Thema, aber für mich zunächst einmal gar nicht so zentral. In meiner Jugend gab es nicht den Drang oder dieses Absolutum, Sängerin zu werden und auf der Bühne zu stehen. Wenn ich zurückblicke, war mein künstlerischer Ausdruck auch damals schon eher ganzheitlich. Ich habe z.B. damit geliebäugelt, Regie zu studieren. Da war es bei aller Zielstrebigkeit vielleicht auch ein bisschen naiv, der Idee zu folgen, Gesang zu studieren. Ich habe tatsächlich auch nur an einer einzigen Musikhochschule vorgesungen und wurde dann glattweg genommen. Aber ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, wenn ich mehrere Anläufe hätte machen müssen und ich mich richtig hätte durchbeißen müssen.
Wie bist du zur zeitgenössischen Musik gekommen?
Wie schon gesagt, ich komme vom Klavier und die Epoche, die mich als junger Mensch am meisten angesprochen hat, war natürlich die Romantik, aber – und das mag jetzt ein bisschen komisch klingen – was mich richtig geflasht hat, das waren die Bach-Fugen. Ich habe es geliebt, mit meiner Klavierlehrerin die Bach-Fugen zu lernen, sie gemeinsam mit ihr zu lesen und zu studieren. Sie hat mich angeleitet, die Strukturen zu verstehen. Was ich da also ganz intensiv gelernt habe, ist musikalische Struktur zu erfassen und gleichzeitig die Harmonien, die Reibung, die Auflösungen, die darin entstehen, wirklich als eine emotionale Aussage zu begreifen. Und zwar nicht beliebig, sondern eben als total durchdacht. Und durch diese Prozesse immer und immer wieder zu gehen, das hat mir das Verständnis und die Offenheit auch für die zeitgenössische Musik gegeben. Indem ich die musikalische Tradition, die Fugen oder eben die Sonatenhauptsatzform verinnerlicht und verstanden hatte, war es mir dann ein Leichtes, die zeitgenössische Musik in ihrer Nicht-Harmonik oder in ihrer freien Rhythmik, oder was auch immer, zu verstehen. Das hat mir Freiheit gegeben und die Berührungsängste vor der vermeintlichen Komplexität von Neuer Musik genommen.
Was ist dein bislang größtes Bühnenabenteuer?
Das kann ich gar nicht so eindeutig beantworten. Was mir in Erinnerung blieb sind zum Beispiel Herausforderungen, wo es ums Eingemachte ging. Ich hatte schon öfter Situationen, dass ich irgendwo kurzfristig einspringen musste. Gerade in der zeitgenössischen Musik – ich bin keine Absoluthörerin – muss ich mir ein Werk wirklich sehr genau erarbeiten. Zum Glück bin ich gut im Blattsingen. Ich habe auch eine relative Coolness, mich in dem Moment einfach hinzustellen und mir zu sagen, ok, jetzt geht es nur darum, mich innerhalb der Noten zu orientieren und das Ganze intuitiv und auf intellektuelle Weise zu bewältigen, d.h. zu lesen, und darauf zu vertrauen, dass sich die Dinge fügen. In Weimar am Nationaltheater bin ich zum Beispiel bei einer Oper eingesprungen und habe die Hauptrolle von der Rampe gesungen. Ich hatte davor genau einen Durchgang im Studierzimmer mit der Studienleitung und dann zack rauf die Bühne vom Blatt. Das war schon sehr abenteuerlich und manchmal liegt man auch einfach daneben und dann braucht man einen Dirigenten oder eine Dirigentin, um einen gut aufzufangen. Aber nach so einer Vorstellung ist man wirklich platt.

Eva Resch
(c) Saskia Allers
Wie findest du zu den Menschen, mit denen du schöpferisch werden kannst?
Es ist so etwas wie Schicksal. Man merkt intuitiv, das könne gut werden. Manchmal täuscht man sich auch, aber meist nicht. Als ich beispielsweise meine erste CD aufnehmen wollte, habe ich mit verschiedenen Labels telefoniert und eben auch mit Michael Silberhorn von Genuin Classics und das war von Anfang an ein Gespräch auf Augenhöhe. Ich hatte sofort das Gefühl, ich muss mich nicht verstellen, ich muss nichts vortäuschen. Es war eine Wellenlänge. Das Gefühl kennt, glaube ich, jeder: die Kommunikation läuft, es lässt sich leicht an, man kommt ins Gespräch. Das ist eine Zusammenarbeit, die ich nicht missen möchte. Ich liebe das: drei Tage im Konzertsaal zu sein und nur unter uns, ganz intim, aufzunehmen und zu arbeiten. Das ist totales Vertrauen. Oder auch mit Eric Schneider: Ich kannte ihn hauptsächlich als Klavierbegleiter von Christine Schäfer, die ich – gerade auch während meines Studiums – sehr verehrt habe. Sie ist eine ganz großartige Sängerin und daher wusste ich, wer Eric Schneider ist. Irgendwann unterhielt ich mich mit einem Kollegen und habe mit ihm überlegt, mit wem ich das Projekt machen könnte und er schlug Eric Schneider vor. Ich zögerte anfänglich, aber dann dachte ich, ja, vielleicht sollte ich ihn einfach kontaktieren. Mit großem Respekt und all meinem Mut habe ich ihn kontaktiert und ihn daraufhin getroffen. Es war eigentlich mit den ersten Takten, die wir zusammen musiziert haben, klar: mit ihm möchte ich arbeiten. Und meine Vorahnung hat sich bewahrheitet: so viel Leidenschaft und so viel Mut im gemeinschaftlichen Musizieren, soviel Energie: das ist genau, was ich liebe. Insofern ist Eric ein ganz toller Partner am Klavier. Solche Begegnungen passieren immer wieder. Es matcht einfach, es ist wie bei den Puzzleteilen, die irgendwann zueinanderfinden.
Auf deinem neuen Album sieht man buchstäblich ROT. Warum?
Der Ausgangs-, Dreh- und Angelpunkt dieses Albums ist ganz banal das Heidenröslein. Das Lied hat mich ehrlichweise nie interessiert, weil es ein Gassenhauer ist, den jeder kennt – zumindest die erste Strophe und den Refrain – aber dann hört es auch schon auf. In der Coronaphase habe ich mich intensiv mit den Schubertliedern beschäftigt und beim Durchblättern des ersten Bandes bin ich auf das Heidenröslein gestoßen. Es hat mich sehr erschreckt, dass ich offensichtlich diesen Text nie verstanden habe. Es ist im Grunde genommen eine Gewaltszene an einer Frau, die da beschrieben ist, vielleicht ist es sogar eine Vergewaltigung, aber auf jeden Fall ist es eine männliche Gewalt. Das hat mich total schockiert. Im Schulunterricht wird das gesungen, wenn das Thema Kunstlied ansteht, aber es wird inhaltlich gar nicht reflektiert und auch ich selber habe das nie hinterfragt. Und da dachte ich, wenn ich das mit diesem Lied nicht gemacht habe, dann gibt es wahrscheinlich noch zig andere Lieder, die man nie wirklich verstanden und richtig kontextualisiert hat. Das war für mich der Auftakt, ins Forschen zu gehen und erstmal nur ganz stupide in der Bibliothek Noten durchzublättern und zu lesen, lesen, lesen… Das war eine sehr assoziative Arbeit, ich habe gar nicht speziell nach Themen oder Texten gesucht. Die Texte sind eher zu mir gekommen. In dieser Offenheit sind mir Lieder begegnet, die nachhaltig in mir etwas angestoßen haben, was ich meinte, wichtig sei, in die Welt zu bringen. Und auch das folgte dramaturgisch erstmal keinem konkreten Plan. Doch nach und nach kam dieser rote (sic!) Faden zum Vorschein und für mich zumindest erzählt dieser mittlerweile inhaltlich eine Geschichte die auch einen Spannungsbogen hat.
Das Album trifft in Wort und Ton (und vor allem auch in den Zwischentönen und -zeilen) den Kern des Menschseins. Es ist ein sehr fokussiertes Album geworden. War das deine Absicht?
Ja, das stimmt. In gewisser Weise kommt hier die Essenz des menschlichen Wesens zum Vorschein. Und mehr noch, inzwischen empfinde ich es sogar als ein sehr weibliches Album. Das ist natürlich bei dieser Farbe auch nicht verwunderlich, aber das war gar nicht die Absicht. Die weibliche Sichtweise und die erschreckende Aktualität sind mir erst im Nachhinein so wirklich bewusst geworden.
Kann man sagen, ROT ist dein bislang persönlichstes Album?
Es ist in jedem Fall ein Projekt, bei dem ich mich von Meinungen anderer unabhängig machen musste. Ich habe für dieses Projekt viele Anträge bei Stiftungen usw. geschrieben, aber war damit letztlich nicht erfolgreich und habe viele Absagen bekommen. Leider. Irgendwann aber war der Zeitpunkt gekommen, zu sagen – egal wie und ob es mir gelingen würde, das Geld zusammenzubekommen – ich muss mich von Meinungen anderer lösen und das Projekt, einem inneren Drang folgend, aus mir heraus entwickeln und umsetzen. Und weil Programm, Dramaturgie, der Text, die Idee für die Fotos, das alles von mir kommt, ist es für mich eine wirklich neue Erfahrung mich so zu zeigen, ähnlich die eines Komponisten vielleicht oder einer Autorin, die ihre eigenen Gedanken in die Welt tragen und die dann Anerkennung finden – oder eben auch nicht.
Welches große Projekt wartet auf dich in nächster Zeit?
Es ist ein rein zeitgenössisches Projekt und wir haben es SMESCH genannt. Das ist kleines Wortspiel von uns als Duo. Das bin also ich, Eva Resch als Sopran und der Cellist Martin Smith. Wir spielen Stücke für Stimme und Cello und diese werden visuell gerahmt durch einen Film. Das nächste Mal spielen wir beim Ultraschall-Festival. Wir setzen uns mit dem Scheitern auseinander. Und tatsächlich, wann immer wir davon erzählen und uns z.B. mit Komponisten und Komponistinnen austauschen – Farzia Fallah wird übrigens auch ein Stück für uns schreiben – dann sagen immer alle: Scheitern – das ist ja genau mein Thema! Ich finde das krass, denn wir wollen ja immer allen zeigen, was wir alles können und nicht, was wir nicht können. Ich sehe das auch bei meinem Sohn, der in die Schule geht. Es geht immer um Leistung und darum, immer alles richtig zu machen. Wir propagieren zwar, weil wir das irgendwo gehört haben, dass Experimentieren der neue heiße Shit des Lernens ist, aber mit dem Scheitern können wir nicht umgehen. Wir haben gar keine positive Konnotation, versagen zu dürfen oder etwas nicht zu können. Dabei sind wir zehnmal vielleicht zum falschen Schluss zu kommen, aber nach dem hunderttausendsten Versuch erfinden wir die Glühbirne. So ist das doch. Es liegt so vieles dem Scheitern zugrunde: man verliert, aber man gewinnt auch. Und das gehört bei jedem dazu. Aber klar, wenn man so in die Welt guckt, ist das Scheitern manchmal dramatisch – auch das gehört zur Wahrheit dazu. Sich mit dem Scheitern zu beschäftigen heißt deshalb auch, sich der Wahrheit zu stellen und diese zu reflektieren. Deshalb ist dieses Thema wirklich existentiell.