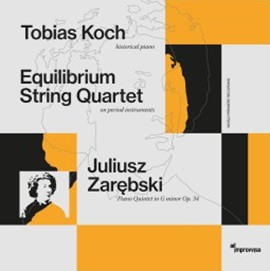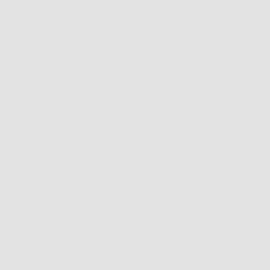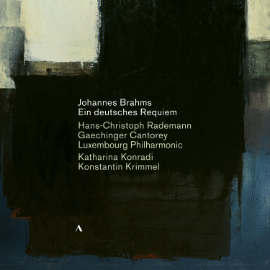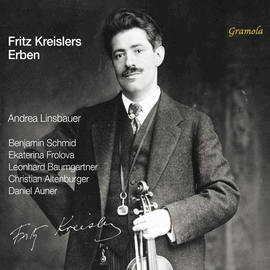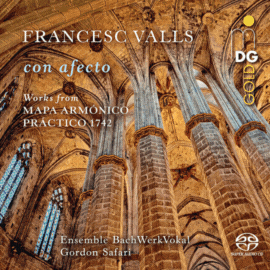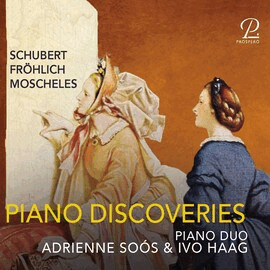Herr Mühlbacher, mit 30 Jahren können Sie bereits auf eine lange Karriere zurückblicken, die als Sängerknabe begonnen hat und Sie momentan zu einem der gefragtesten Countertenören unserer Zeit macht. Wurde Ihre Wahl zum Fach des Countertenors von Ihrer Stimme begründet oder wie kam es dazu?
Ich habe schon als Kind ständig gesungen. Da meine Eltern bemerkten, dass ich eine sehr laute, aber auch hohe und schöne Stimme hatte, durfte ich bei den St. Florianer Sängerknaben vorsingen und wurde dort aufgenommen. Das Singen im Chor und bald auch als Sopransolist hat mir ungemein Spaß gemacht. Als ich in den Stimmbruch kam, hatte ich große Angst, meine helle Stimme zu verlieren. So habe ich dann sehr viel geübt und daran gearbeitet, meine Knabensopranstimme zu erhalten. Der Weg in Richtung Countertenor war damit ganz natürlich vorgezeichnet.
Ihre Sprechstimme ist aber eher tief und ich habe auch gelesen, dass Sie als Sänger ebenso gut Bass-Baritonpartien singen können.
Das stimmt. Meine Modalstimme ist tief und ich könnte auch den Sarastro in Mozarts Zauberflöte singen. Ich habe diese Bass-Baritonstimme ebenfalls trainiert, oder – besser – mittrainiert, weil ein tiefes Fundament auch im Counter-Tenorfach sehr hilfreich ist. Ich kann also durchaus Bass-Bariton singen, allerdings jetzt nicht auf Weltklasseniveau. Aber es geht. (lacht)
Alfred Deller war in den Fünfzigerjahren einer der ersten populären Countertenöre. Was hat sich seither in diesem Bereich verändert?
Alfred Deller war für uns Countertenöre natürlich sehr wichtig, weil er einerseits zeigte, wie vielseitig diese Stimmlage doch ist, und wie anders und interessant das Repertoire durch sie wird oder wahrgenommen werden kann. Es kam zu einem regelrechten Boom, auch weil er zeigte, wie schön diese Falsettstimme ist und was sie alles ausdrücken kann. Durch die hohe Spannung und die hohen Frequenzen kann der Counter-Tenor oft quasi überirdisch klingen und den Eindruck vermitteln, als würde die Zeit stehen bleiben.
Wie kann man die plötzliche Beliebtheit dieser Stimmlage erklären, die eigentlich mit Andreas Scholl in den neunziger Jahren einen neuen Aufschwung erlebt hat.
Ich denke, der Countertenor hat seinen Aufschwung einigen wichtigen Interpreten zu verdanken, wie eben Andreas Scholl, aber auch Paul Esswood oder Jochen Kowalski und vielen anderen. Das hat dann auch dazu geführt, dass viele Opernintendanten und Dirigenten das Wagnis eingingen, Rollen alternativ zu besetzten. So kann Mozarts Cherubino durchaus von einem Countertenor gesungen werden. Diese Initiativen entpuppten sich oft als Bereicherung und kamen auch beim Publikum gut an. So wurde der Markt größer und die Ausbildung besser.
Wie lange kann man denn als Countertenor auf höchstem Niveau singen. Ich gehe davon aus, dass gerade die se hohe Lage auch sehr anfällig ist.
Wenn die Ausbildung gut, die Substanz vorhanden und die Basis sicher ist, dann kann man sehr lange singen. Das hängt, wie bei beim jedem Sänger, auch von der körperlichen Verfassung ab. Aber es gibt auch ein Verfallsdatum: Nach dem 50. Lebensjahr muss man einen Gang zurückschalten. Man kann vielleicht immer noch lange und gut singen, aber man soll dann schon sehr vorsichtig bei der Repertoireauswahl sein.
Auf Ihrer bereits vierten CD, Broken Eyes, die bei Solo Musica erschienen ist, singen Sie Bachkantaten, begleitet von Ihrem eigenen Ensemble Pallidor. Bach oblige? Auch für einen Countertenor?
Für mich jedenfalls. Bach gehört zu meinem Repertoire, seit ich Kind bin. Das deutsche Repertoire ist mein Repertoire, da fühle ich mich zuhause. Aber natürlich locken auch die großen italienischen Partien. Bach war sehr wichtig für mich. Wissen Sie, als Kind lernt man diese Musik ganz spielerisch, ohne Theorie oder historischen Kontext. Als Sängerknabe konzentriert man sich nur auf die Musik. Und demnach auf das Gefühl, auf die Emotionen, die diese Musik transportiert. Und diese ‘kindliche’ Herangehensweise versuche ich mir auch heute noch zu erhalten.
Der Dirigent des Ensembles ist Franz Farnberger, ehemaliger Leiter der Wiener Sängerknabenund jetzt der St. Florianer Sängerknaben, denen Sie ja auch angehörten. Was prägt die intensive Zusammenarbeit mit ihm?
Wir kennen uns seit 20 Jahren und er war und ist mein wichtigster Mentor. Es besteht eine sehr enge künstlerische Verbindung zwischen uns und wir haben auch ähnliche Sichtweisen bezüglich der Interpretation und der Gesangstechnik. Was ja auch nicht verwundert, denn Franz Farnberger hat meine Stimme mitausgebildet. Und weil wir so wunderbar miteinander harmonieren, haben wir zusammen das Ensemble Pallidor gegründet, mit dem wir unsere eigenen Konzepte bestmöglich umsetzen können. Wenn ich mit anderen Dirigenten arbeite, ist das Resultat meistens völlig anders. Aber auch das erweitert natürlich den künstlerischen Horizont.
Countertenöre werden gerne ausschließlich auf das Barockrepertoire festgelegt. Dem ist aber nicht so.
Ja, früher war das so, heute geht man weitaus offensiver mit den Möglichkeiten um. Und beim Publikum hat sich inzwischen eine regelrechte Fanbase entwickelt. Die Zuhörer ziehen wirklich mit, und das ist beflügelnd. Ich bin beispielsweise Teil einer Produktion in Genf, wo 5 Countertenöre zusammen auftreten. Das wird ein virtuoses Feuerwerk.

Alois Mühlbacher
(c) Toni Suter
In der klassischen Opernliteratur gibt es Rollen, die heute gerne mit einem Countertenor besetzt werden. Ich denke da an die Hexe in Humperdincks Hänsel und Gretel oder an Prinz Orlofsky in der Fledermaus. Könnte man sich vorstellen, auch sogenannte Charakterrollen wie beispielsweise Loge im Rheingold, Herodes in Salome oder den Hauptmann in Wozzeck mit einem Countertenor zu besetzen. Sänger wie Gerhard Stolze oder Heinz Zednik waren ja schon manchmal sehr nahe an dieser Stimmlage dran.
Oder der Octavian im Rosenkavalier von Richard Strauss. Es gibt in dieser Hinsicht viele Experimente, auch solche, die sicher diskutabel sind, wie beispielsweise die Donna Elvira in Mozarts Don Giovanni mit einem Countertenor zu besetzen. Für mich ist das Konzept wichtig. Und es muss sangbar sein. Und Spaß machen. Solche Initiativen können das Repertoire nur erweitern. Ich singe auch Pop-Arrangements und romantische Lieder von Mahler und Strauss.
Sie singen aber nicht nur, sondern sind seit 2024 ebenfalls Leiter des Barock Festivals St. Pölten. Was ist für Sie das Interessante an diesem Festival.
Als ich das Festival als junger Intendant übernommen habe, war klar, dass ich auch neue Wege gehen wollte. Es ist ein kleines Festival mit neun Vorstellungen, aber ich versuche, das Barockrepertoire aus verschiedenen Perspektiven anzugehen. Es gibt klassische Konzerte, aber es gibt auch Veranstaltungen, wo die Barockmusik mit zeitgenössischer Kunst, mit Literatur und Tanz kombiniert wird. Für mich ist es ideal und sehr bereichernd, klassische Konzerte mit experimentellen Konzepten in ein und demselben Festival zusammenzubringen.
Wie ist Ihr Verhältnis denn zur zeitgenössischen Musik?
(lacht) Sehr gut. Ich singe regelmäßig zeitgenössisches Repertoire und es gibt viele Komponisten, die Werke für mich schreiben. Das Klischee des Barocksängers trifft demnach nicht auf mich zu. Ich liebe die Herausforderung und freue mich immer auf neues Repertoire. Am Theater an der Wien singe ich im Dezember 2025 beispielsweise die Hauptrolle in der Oper Ich bin Vincent! von Gordon Kampe. Es ist vom Genre her eine Kinder- und Jugendoper, die sich mit dem Thema Mobbing auseinandersetzt. Ein Projekt, auf das ich mich besonders freue!
Musik für Kinder und Jugendliche. Ein Thema für Sie? Sie sind beispielsweise in der Luxembourger Philharmonie ebenfalls in einem Kinderprogramm aufgetreten.
Unbedingt! In der Philharmonie Luxembourg habe ich in zwei Tagen sechs Vorstellungen von Loopino et le petit homme de la lune gesungen. Dieses Programm war für Kinder von 3 bis 5 Jahren entwickelt. Ich denke, man kann nie früh genug mit der Musik anfangen und es ist schön zu sehen, dass alle großen Konzerthäuser nun solche Kinder- und Familienkonzerte anbieten. Kinder brauchen kein theoretisches Grundwissen; sie erleben alles von der emotionalen Ebene aus. Ich ziehe da auch gerne Parallelen zu meinen ersten Jahren als Sängerknabe. Die Musik war für mich ein großer Spielplatz, da konnte ich mich unbefangen austoben und diese schöne Kunst vorbehaltlos und spielerisch erleben und für mich entdecken. In meiner Entwicklung habe ich diesen unbeschwerten Zugang dann auch irgendwann fast verloren, besonders während des Studiums, wo die Theorie plötzlich in den Vordergrund rückte. Aber ich habe glücklicherweise diesen „kindlichen“ Zugang wiedergefunden und ich hege ihn wie einen Schatz, denn er ermöglicht es mir, die Musik emotionaler, ehrlicher und unbefangener zu interpretieren. Und das ist schön.
Mit 30 Jahren sind Sie ein bereits fest etablierter Künstler. Was sind denn weitere Zukunftswünsche oder Traumrollen?
Oh, da gibt es sicherlich viele. Ich denke, als nächstes werden die großen Händelrollen wie Rinaldi, Cesare, Serse oder Ottone an der Reihe sein. Natürlich auch spannende Projekte mit Franz Farnberger und unserem Ensemble Pallidor. Und natürlich auch immer wieder außergewöhnliche Experimente. Aber das Wichtigste in unserem Beruf scheint mir doch eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit allen Partnern zu sein. Denn dann kann man wirklich gute Musik machen.
Interview: Alain Steffen