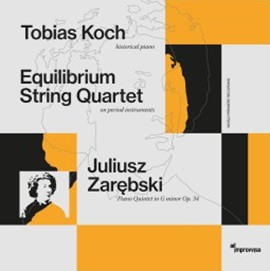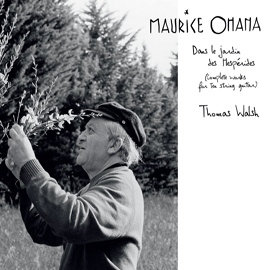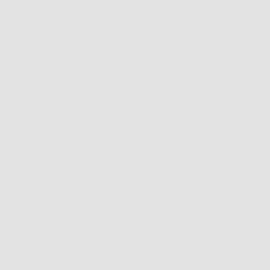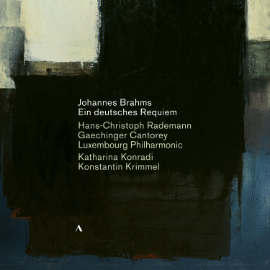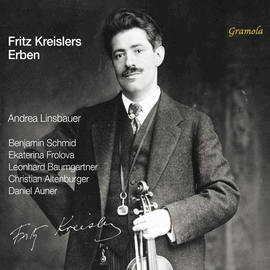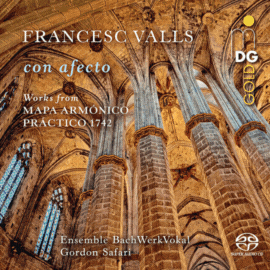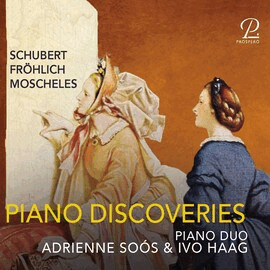Das Fauré Quartett, ein ständiges Klavierquartett, gastierte im Brahms-Saal des Musikvereins Wien. Uwe Krusch war für Pizzicato beim Konzert dabei, in dem eher Unbekanntes und sehr Bekanntes aufeinander trafen.
Das Quartett in der Besetzung Dirk Mommertz, Klavier, Erika Geldsetzer, Violine, Sascha Frömbling, Viola und Konstantin Heidrich, Violoncello eröffnete den Abend mit Adagio e Rondo concertante für Klavier und Streicher von Franz Schubert. Dieses Ausnahmewerk im Kammermusikschaffen Schuberts folgte dem Usus, ein Klavierkonzert in kleiner Besetzung zu spielen, wie es mit den Klavierkonzerten von Mozart oder Beethoven bekannt war. Diese Tradition griff der 19-jährige Schubert in Adagio e Rondo concertante auf.
Angeregt zu der Komposition wurde er von der Witwe Grob, wo der junge Abiturient zu der Zeit wohnte und ein Haus vorfand, in dem viel musiziert wurde. Dem Sohn des Hauses und seinem Freund, Heinrich G., setzte er damit ein pianistisches Denkmal, was sich im konzertanten Stil des Werkes niederschlägt. Führte die Interpretation durch das Fauré Quartett in der pathetisch langsamen Einleitung noch in die Salonmusik der 1810-er Jahre, so zeigten sie im Rondo, dass dieses Stück den Klavierkonzerten Mozarts verpflichtet ist. Es gelang den Interpreten beispielhaft, die romantisch-nächtlichen Stimmungen des Adagio zu zeichnen, wie auch im Rondo bis zur Brillanz wie bei einem veritablen Virtuosenkonzert vorzudringen.

Mel Bonis
Es folgte das 1. Quartett B-Dur op. 69 von Mel Bonis, eigentlich Melanie Bonis. 1905 komponiert, zeigte das Werk die reife Komponistin. Das den Gesetzen der Sonatensatzform nicht mehr eng folgende Werk, dass man beinahe auch als Suite in vier Sätzen auffassen könnte, zeichneten die Interpreten mit seiner progressiven Tonalität und den bemerkenswert experimentellen Strukturen inspiriert nach, was die Ernsthaftigkeit des Stückes aber auch ihrer Befassung damit herausstellte. Wiederum kam dem Klavier die vorherrschende Rolle zu, was Dirk Mommertz nicht in Verlegenheit brachte. Im Gegenteil wusste er auch diesen Part farbenreich und gestalterisch durchleuchtet zu präsentieren. So gelang es dem Pianisten und dem Trio der Streicher, auch die melodisch und harmonisch reiche Seite des Werkes mit den raffinierten impressionistischen Färbungen zu heben.
Das 2. Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello in A-Dur op. 26 von Johannes Brahms stellte das weitaus bekannteste Werk der Auswahl des Abends dar. Auch hier hatte der selbstkritische Komponist bis zuletzt, sogar noch in den Proben für die Uraufführung, Änderungen eingearbeitet. So tauschte er ganze Passagen im Streichersatz aus, veränderte Lagen und Stimmführungen, ja sogar Motive, um die richtige Balance zu erreichen.
Das Fauré Quartett glänzte auch hier mit sensitiv aufeinander abgestimmten Ensemblespiel, dass immer das Klavier prominent zeigte, aber niemals die Streicher verdrängte, die sich untereinander bestens abgewogen hören ließen. Im ersten Satz gelang es ihnen, die auf die Rhythmik, weniger Melodik und Harmonik geprägte Durchführung des Sonatensatzes mit schlichter Eleganz auszukosten. Dazu zeigten sie klar und deutlich den im Klavierthema des Anfangs angelegten Gegensatz von Achteltriolen und Dreiergruppen aus einfachen Achteln, der den gesamten Satz bestimmt. Darüber hinaus ergötzten sie sich und das Auditorium mit den von verschwenderischer Hand gestreuten gesanglichen Themen.

Johannes Brahms
Das Poco Adagio, auf der einfachen Idee beruhend, eine Klaviermelodie von den Streichern con sordini umspielen zu lassen, bildete das Fauré Quartett genau so charmant einfach ab, wie es gesetzt war. In der Reprise konnten die Streicher diese Melodie in hoher Lage ohne Dämpfer übernehmen. Die Referenz an Mozart in der Mitte des Satzes mit Streichtriotakten von himmlischer Schönheit kosteten die vier Musiker gekonnt aus.
Die Zitatensammlung, also das Scherzo eröffneten sie heiter in kontrapunktisch meisterhaftem Spiel, gefolgt von einem wilden Trio à la Brahms, in dem sie sich ausleben konnten und trotzdem immer die Kontenance bewahrten. Im Finale im ungarischen Stil entlockte das Quartett auf den Tasten bzw. den Saiten mit Spielfreude, aber immer fokussiert auch hier das Idiom der Komposition.
Bei den gesanglichen Themen des Kopfsatzes bei Brahms’ Quartett lag die Zugabe, das gerne vom Ensemble gespielte Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello Es-Dur op. 47 von Robert Schumann nahe. Hieraus ließen sie den 3. Satz, Andante cantabile, für den erstaunlicherweise nicht voll besetzen, aber begeisterten Saal erklingen.