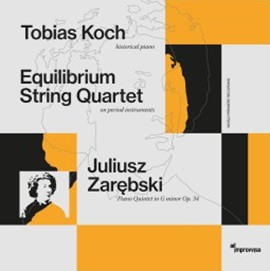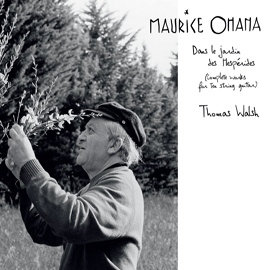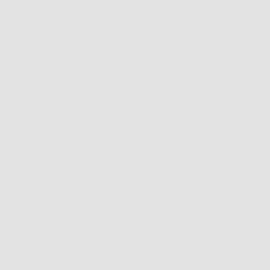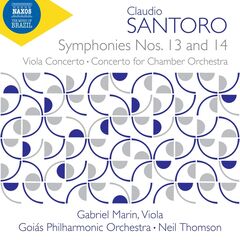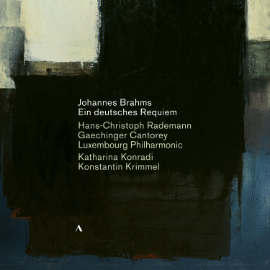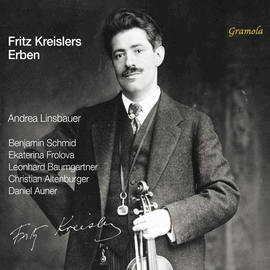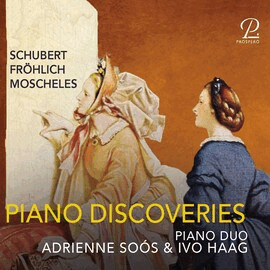Das Philharmonische Orchester Goias und sein künstlerischer Leiter Neil Thomson widmen sich seit einiger Zeit dem Werk von Claudio Santoro. Vier Kompositionen aus dem letzten Lebensjahr des brasilianischen Komponisten sind mit etwa 10 bis 22 Minuten jeweils nicht allzu lang. Das tut aber ihrer Intensität keinen Abbruch, vielmehr verdichtet es sie.
Die 13. Symphonie ist ein Schlüsselwerk des letzten Jahres. Sie entstammt der Zeit persönlicher Krisen und bietet ihre Motive mit Vehemenz an. Die Musiker aus Goias eröffnen das Werk mit einer geheimnisvollen Einleitung, bevor sie einen ersten Höhepunkt finden, in dem sie die treibende rhythmische Zelle mit rasender Energie vorstellen. Anspruchsvolle Streicherpartien vermitteln eine zuvor von Santoro noch nicht gehörte Atmosphäre der Gewalt. Die Spannung hält im zweiten Satz an, obwohl Soli zunächst eine Barkarole suggerieren. Es folgt das brillant orchestrierte Scherzo, bevor das Finale die düstere Haltung wieder aufnimmt.
Die Symphonie Nr. 14 schrieb Santoro formal konventioneller als die 13. Symphonie. Dadurch wird eine wirkungsvolle Prägnanz erreicht. Mit großer Energie werden alle Instrumente reihum beteiligt, bis unerwartet ein origineller Kontrast in der Dynamik überraschend zum Ende führt. Auf den lyrischen Mittelsatz folgt ein Finale, dessen Motiv von den tiefen Instrumenten eingeführt und in Transformationen durchs Orchester geführt wird.
Wie die anderen späten Werke zeichnet sich auch das Bratschenkonzert durch emotionale Dichte aus. Ausgangspunkt ist ein energisches rhythmisches Thema, gefolgt von einem ausdrucksstärkeren zweiten, bis der Satz abrupt in einer Coda endet. Im lyrischen zweiten Satz, den eine raumgreifende Melodie der Bratsche über subtiler Begleitung von Harfe, Celesta und Streichern beherrscht, wird diese friedliche Stimmung kurz durch eine bewegte Passage des Solisten unterbrochen. Das gequälte Tutti des Orchesters im dritten Satz prägt diesen. Dennoch darf sich der Solist technisch entfalten.
Das Konzert für Kammerorchester, für 16 Solostreicher geschrieben, lassen die Interpreten meditativ mit weiten Phrasen und dynamischen Kontrasten beginnen. Im folgenden Moderato akzentuieren die Musiker das Hauptmotiv mit Sprüngen in großen Intervallen. Den kurzen Epilog bietet die Aufnahme angemessen trostlos dar.
Der Solist Gabriel Marin zeigt dieses Solokonzert, eines der wenigen Beispiele aus Brasilien, in einer ebenso die klanglichen Eigenheiten der Bratsche hervorhebenden wie auch die technischen Aspekte in reifer Darstellung anbietenden Deutung an, so dass er eine sehr überzeugende Interpretation des Soloparts beisteuert.
Das Orchester, im Kosmos Santoro unbeirrbar zielstrebig unterwegs, lässt mit seinen Interpretationen diese Stimme aus dem größten südamerikanischen Staat mit Erfolg vernehmen, woran Neil Thomson seinen Anteil hat.
The Goias Philharmonic Orchestra and its artistic director Neil Thomson have been devoting themselves to the work of Claudio Santoro for some time now. Four compositions from the Brazilian composer’s last year of life are not too long, ranging from 10 to 22 minutes each. However, this does not detract from their intensity; rather, it intensifies it.
The 13th Symphony is a key work from the composer’s last year. It was written during a period of personal crisis and presents its motifs with vehemence. The musicians from Goias open the work with a mysterious introduction before reaching a first climax, in which they present the driving rhythmic cell with frenzied energy. Demanding string parts convey an atmosphere of violence not previously heard from Santoro. The tension continues in the second movement, although solos initially suggest a barcarolle. This is followed by the brilliantly orchestrated scherzo, before the finale resumes the somber mood.
Santoro wrote his Symphony No. 14 in a more conventional style than the 13th. This gives it a powerful conciseness. All the instruments are involved in turn with great energy, until an unexpected and original contrast in dynamics leads to a surprising conclusion. The lyrical middle movement is followed by a finale whose motif is introduced by the low instruments and carried through the orchestra in transformations.
Like his other late works, the Viola Concerto is characterized by emotional intensity. It begins with an energetic rhythmic theme, followed by a more expressive second theme, until the movement ends abruptly in a coda. In the lyrical second movement, dominated by a sweeping melody on the viola over subtle accompaniment from the harp, celesta, and strings, this peaceful mood is briefly interrupted by a lively passage from the soloist. The tormented tutti of the orchestra in the third movement characterizes this movement. Nevertheless, the soloist is allowed to develop technically.
The Concerto for chamber orchestra, written for 16 solo strings, allows the performers to begin meditatively with broad phrases and dynamic contrasts. In the following Moderato, the musicians accentuate the main motif with leaps in large intervals. The recording presents the short epilogue in an appropriately desolate manner.
Soloist Gabriel Marin presents this solo concerto, one of the few examples from Brazil, in an interpretation that highlights the tonal characteristics of the viola as well as offering a mature presentation of the technical aspects, thus contributing a very convincing interpretation of the solo part.
The orchestra, unwaveringly determined in Santoro’s cosmos, successfully conveys this voice from South America’s largest country with its interpretations, to which Neil Thomson has contributed.