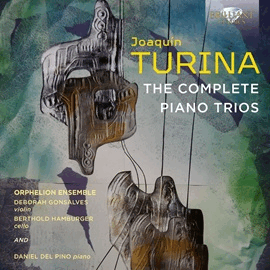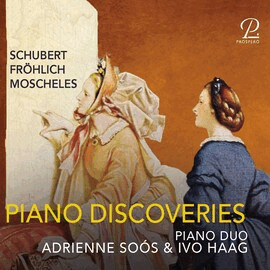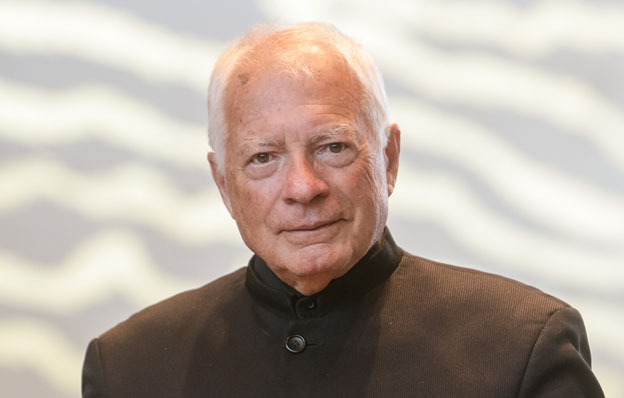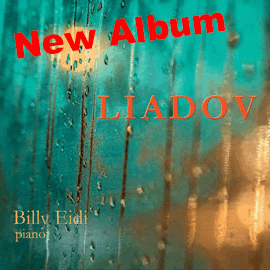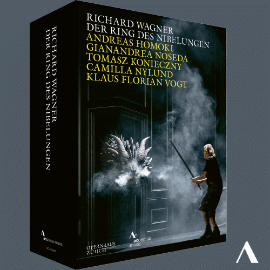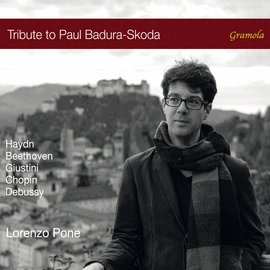Redlichkeit, Strenge und Effizienz: Das sind die wichtigsten Stärken von Leopold Hager, die sich schon in der Tannhäuser-Ouvertüre zeigen, dem ersten Werk auf dem Programm des Abends, der am 2. Oktober in der Philharmonie zu einem bewegenden Wiedersehen mit dem heute 90-Jährigen wurde, der das Hausorchester neun Jahre lang, von 1987 bis 1996, dirigiert hatte. José Voss berichtet.
Wenn man den edlen Ton lobt, den der alte, aber immer noch wache und lächelnde österreichische Bekannte von Anfang an anschlägt, und wenn man sein feines Gespür für Proportionen und Tempi hinzufügt, wird man verstanden haben, dass die emotionale Spannung hier weniger aus dem Geheimnis als aus der Klarheit entsteht, mit der die subtile Polyphonie dieser berühmten Wagner-Seite wiedergegeben wird. Eine erfrischende Aufführung, die jedoch nicht radikal in Frage gestellt wird; eine wunderbare, gewissermaßen sehr « klassische » Lesung, aber im besten Sinne des Wortes.

Richard Wagner
« Ich habe nichts Besseres gemacht als diese Lieder, und nur ein sehr kleiner Teil meines Werkes kann mit ihnen verglichen werden », schrieb Wagner an Mathilde über die fünf Wesendonck-Lieder, die er ihr widmete. Diese Lieder sind selbst für die fähigsten Sängerinnen gefährliche Stolperfallen, denn ihre schwärmerische Lyrik und die übertriebene Chromatik können ihre stimmlichen Ressourcen schnell erschöpfen. Aber was soll’s? Die französische Mezzosopranistin Eva Zaïcik wurde am Pariser Konservatorium von Élène Golgevit unterrichtet, und man hört es an der Art und Weise, wie sie ihre Stimme projiziert und ihre Höhen mit einem fast blendenden Licht ausleuchtet. Diese Stimme ist wie eine sanfte Liebkosung, eine Liebeserklärung (auch wenn sie unmöglich ist), die das Herz zusammenschnürt, und sie kann auch Schreie existenziellen Schmerzes aushalten. Und wie kunstvoll ist der Stil! Und der Ausdruck ist durchdringend! Und der Salzburger Dirigent wendet die Tricks eines Sioux an, um die Lava dieses stimmlichen Vulkans und die fieberhafte Leidenschaft dieser neuen Lieddiva zu kanalisieren.
Die Sinfonie Nr. 3 in d-Moll, die sogenannte Wagner-Sinfonie, ist dem Autor des Tristan gewidmet (der von Bruckner, der 1863 bei einer Aufführung des Tannhäuser in Linz in den Bann von Wagners Musik gezogen wurde, immens verehrt wurde) und wird in den Konzertsälen kaum beachtet. Gegenüber dieser sowohl in interpretatorischer Hinsicht als auch in Fragen der Editionsauswahl schwierigen Symphonie ziehen die Programmverantwortlichen in der Regel die vierte, fünfte, siebte oder sogar achte Symphonie vor. Und doch! Obwohl die ersten drei Sinfonien des « Gottesmenschen » auch heute noch als die schwächsten Meilensteine der Serie erscheinen, ist die Dritte dennoch von einer höchst anspruchsvollen Spannung sowie von epischem Atem und hieratischer Größe erfüllt. Außerdem hat sie in Hager einen erstklassigen Anwalt gefunden. Und man muss sagen, dass der ehrwürdige Veteran am Taktstock (manchmal ist Reife ein Vorteil) mit der Wahl der Version von 1889 die richtige Entscheidung getroffen hatte.

Anton Bruckner
Auf einen ätzenden ersten Satz, der mit « Mäßig bewegt » notiert ist, folgte ein wagnerianisches Adagio (das zweite Thema ist in der Tat eine deutliche Reminiszenz an das « Schlaf »-Motiv im dritten Akt von « Die Walküre »), eine Episode, die von völliger Düsternis geprägt ist. Im folgenden Scherzo kam es zu einem Wirbelsturm der Geigen über Bass-Pizzicato. Ein « perpetuum mobile », das schließlich in eine Art ruhig tanzenden, sehr « wienerischen » Ländler mündete. Das Finale, in dem sich die Blechbläser majestätisch entfalteten, schloss das Werk auf eine Weise ab, die grandioser nicht hätte sein können.
Was kann man schließlich über die Interpretation sagen, außer dass sie das innere Feuer mit einer bewährten Donau-Tradition, eine spirituelle Projektion des romantischen Materials mit einer Weite des Atems verband. Dadurch war diese Interpretation nicht nur auf Kurs, sondern es fehlte ihr letztlich auch nichts, um beim Zuhörer die unmittelbarsten, urwüchsigsten und tiefsten Emotionen hervorzurufen. Ein Gefühl der Erschütterung und Regeneration.