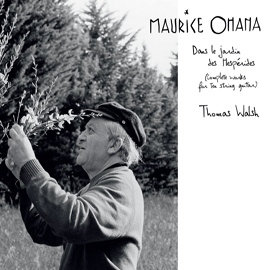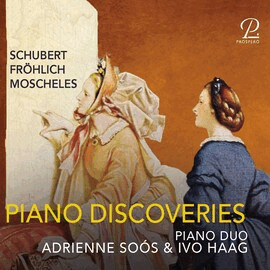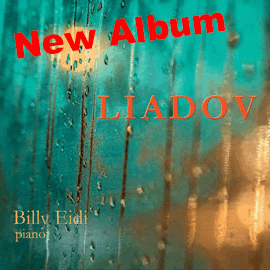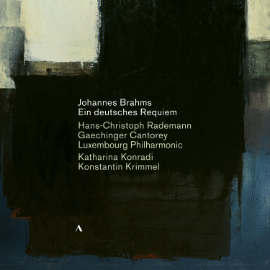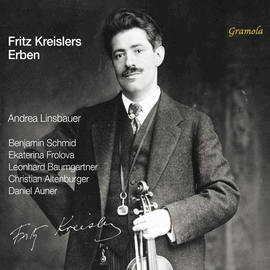Eine perfektere Orchesterstunde hätte man sich nicht wünschen können. Von der flirrenden Komplizenschaft in Benjamin Brittens Violinkonzert bis zur obsessiven Kraft der Symphonie Nr. 10 von Dmitri Shostakovich führte Antonio Pappano – italienisch in der Kultur, angelsächsisch in der Ausbildung – das London Symphony Orchestra am 23. September in der Luxemburger Philharmonie zu überwältigenden Höhen der Intensität. José Voss berichtet.
Das Werk von Britten, der oft als der größte britische Komponist seit Henry Purcell bezeichnet wird, wurde nur wenige Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fertiggestellt und spiegelt die düstere und verstörte Atmosphäre dieser zunehmenden Gefahr wider. Wie könnte man nicht ein martialisches Hämmern, das Geräusch von Militärstiefeln in dem obsessiven Schlagzeugrhythmus erkennen, der, bevor er vom Solofagott übernommen wird, dumpf den ersten Einsatz der Solistin Janine Jansen punktiert?

Janine Jansen
Der zutiefst pazifistische und antimilitaristische Engländer verströmt in seiner Musik seine Angst und Bitterkeit angesichts des dramatischen Kurses, den die Geschichte unausweichlich genommen hat. Brittens Violinkonzert steht wie Beethovens Violinkonzert in D-Dur und endet wie das von Alban Berg (den er bewunderte) mit einem langen Finale in Form einer Passacaglia, das bei einem jungen Komponisten von gerade einmal 25 Jahren von einer erstaunlichen Reife und Meisterschaft zeugt, sowohl was die melodische Erfindung als auch was die kunstvollen Zaubereien der Orchestrierung betrifft.
Das gequälte Spiel der niederländischen Geigerin, die sich ganz in die gequälte Welt des Schöpfers des Konzerts hineinversetzt, spiegelt auf wunderbare Weise dessen Besorgnis über die tragische Wendung der Ereignisse im Jahr 1939 wider. Das Publikum war sichtlich begeistert, bestand darauf und entlockte der Violinistin eine erhabene Zugabe von J. S. Bach.
Brittens gequälter Schmerzensschrei, den Elliott Carter als « englisches Gegenstück zu Shostakovichs Musik » bezeichnete, wurde nach der Pause von dem sowjetischen Komponisten mit einem Lied der Zerrissenheit beantwortet. Diese vehemente Anklageschrift eines « inneren Dissidenten » (Opfer der verfolgten Anhänger des ‘Kleinen Vaters der Völker’) wurde am 25. Oktober 1953, also nur sieben Monate nach Stalins Tod, fertiggestellt, von Träumen zu Schreien, von Fragen zu Hoffnungsschimmern, die ihn mit Vorwürfen überhäuften, indem sie ihn mal als « Schwätzer », mal als « pathologische Kakophonie » bezeichneten – « Vater », der in Wirklichkeit einer der schlimmsten Diktatoren der Geschichte war), ist unwiderruflich: Ehre der Wahrheit, der Freiheit der Schöpfung, dem Humanismus!
« Ich habe versucht, die Gefühle und Leidenschaften des Menschen auszudrücken », erklärte der Komponist lakonisch und bescheiden am Tag nach der Aufführung seiner Zehnten am 17. Dezember 1953 unter der Leitung von Evgeny Mravinsky. Dennoch hat der Russe zweifellos Beethovens herkulische Kraft geerbt. In diesem bedeutenden Denkmal für den Humanismus ist oder wäre das Allegro, eine teuflische, erstickende, holprige Verfolgungsjagd mit unerhörter Ausdrucksgewalt, ein Porträt Stalins, während das Allegretto das Motiv DSCH-Motiv zitiert. Um sich vor Kritik zu schützen, verwandelte der Komponist das Finale in eine optimistisch anmutende Hommage an den Bonner Titanen.

Antonio Pappano
Photo: Musacchio & Ianniello
Aufgrund seiner polyphonen Komplexität ist die Aufführung dieses virtuosen Werks, das sinnbildlich für einen Musiker steht, der sich gegen Barbarei, Intoleranz und Ungerechtigkeit wehrt, eine Herausforderung für jeden Dirigenten: Er muss das Ineinandergreifen der besonders kontrastreichen Stimmungen (gewalttätig, sardonisch, tragisch, ironisch) definieren, ohne dabei die Gesamtarchitektur der Partitur aus den Augen zu verlieren.
Das LSO, das von Pappano mit einem Dirigat, dessen enthusiastischer Eifer ansteckend ist, förmlich getragen wurde, bot uns von diesem düsteren symphonischen Mahlstrom (der nach der Invasion in der Ukraine leider nicht aktueller sein kann) eine Lesart, die nicht nur intensiv und gewissenhaft war und eine beispielhafte Ausdrucksfülle aufwies. Sie trug die Handschrift des Mannes, der wegen seines kraftvollen und emotionalen symphonischen Stils und seiner regelmäßigen Rückbesinnung auf klassische Formen oft als ‘russischer Beethoven’ bezeichnet wird.