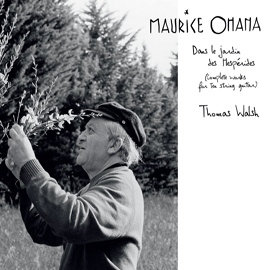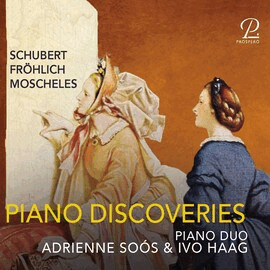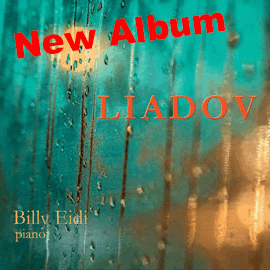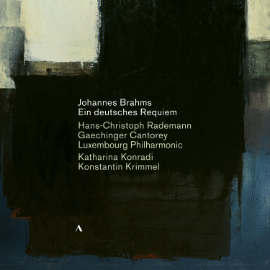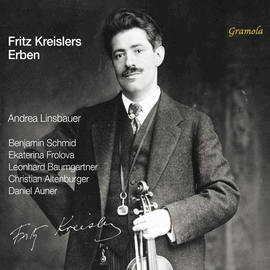Die neue Spielzeit in der Philharmonie begann mit einem doppelten Paukenschag. Die Berliner Philharmoniker spielten unter Kirill Petrenko Gustav Mahlers letzte vollendete Symphonie, die emotional überwältigende Neunte. Alain Steffen war für Pizzicato dabei.
Im Gegensatz zu den Wiener Philharmonikern oder dem Concertgebouw Orchestra Amsterdam sind die Berliner Philharmoniker kein ausgewiesenes Mahler-Orchester, das auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Vor 1930 gab es einige bemerkenswerte Aufführungen, wie die Uraufführung der 2. Symphonie durch Mahler selbst, sowie 1907 ein Konzert mit der Dritten mit Mahler am Pult oder 1924/25 gar den ersten Mahler-Zyklus in Deutschland.
Arthur Nikisch, Chefdirigent des Orchesters von 1895 bis 1922 führte Mahlers Musik regelmäßig auf. Nach dem 1. Weltkrieg waren es dann Dirigenten wie Bruno Walter, Oskar Fried, Hermann Scherchen, Felix Weingartner oder Jascha Horenstein, die Mahlers Werke populär machten. Wilhelm Furtwängler, der 1922 als Chefdirigent des Orchesters auf Nikisch folgte, hatte vor allem in seinen frühen Jahren ein gutes Verhältnis zu Mahlers Musik. Nach dem Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft, bei der Mahlers Werke sowieso nicht aufgeführt werden durften, dirigierte Furtwängler, der erst 1952 wieder als Chefdirigent eingesetzt werden durfte, keine Mahler-Symphonie mehr mit den Berliner Philharmonikern. Auch Herbert von Karajan, der das Orchester 1954 nach Furtwänglers Tod übernahm, fand erst sehr spät zu der Musik von Gustav Mahler und spielte in den späten Siebzigerjahren Das Lied von der Erde sowie die Symphonien Nr. 4, 5, 6 und 9 ein. Erst mit der Verpflichtung von Claudio Abbado und anschließend Simon Rattle begannen die Werke von Mahler, zum Kernrepertoire der Berliner Philharmoniker zu werden. Heute führt Kirill Petrenko, seit 2019 Chef der Berliner Philharmoniker diese Tradition weiter. Nach der Vierten, Sechsten und Siebten folgte nun die Neunte, mit der er und sein Orchester im Moment auf Tournee sind.
Die Neunte als zukunftsweisendes Werk
Mahlers 9. Symphonie ist ein Werk des Abschieds und eine Aussöhnung mit dem Tod, doch Petrenko sieht noch einen anderen, ebenso wichtigen Aspekt in diesem Werk. “Für mich ist das eher ein Werk des Aufbruchs-des Aufbruchs in die Moderne. Nicht umsonst haben Schönberg, Berg oder Adorno gerade diese Symphonie als Initialzündung gesehen, als Übergang vom klassischen in das freitonale Zeitalter.“ Wer sich also einen leidenschaftlich-schmachtenden Mahler à la Bernstein oder einen düsteren Höllenritt im Sinne Otto Klemperers erwartet hatte, wurde enttäuscht. Petrenkos Mahler orientiert sich viel eher an Tennstedt, Boulez und Abbado ohne diese aber je zu kopieren. Petrenkos Mahler ist ein Mahler der Gegensätze.

Kirill Petrenko
(c) Alfonso Salgueiro
Ein tiefschürfender Kopfsatz vermittelte den Eindruck, als wolle Mahler noch ein letztes Mal alles aus der Kategorie Symphonie herausholen und parallel dazu neue Wege aufzeigen. Lustvoll wurde anschließend in den beiden Mittelsätzen die Symphonie quasi in kleine Stücke zerrissen, vieles klang schief, Melodien verloren sich, Ideen vermischten sich zu einem grotesken Tanz der Absurdität. In Petrenkos Interpretation kam nur selten das Gefühl von Hoffnungslosigkeit oder gar Tod auf. Diese Symphonie erhob keinen Anspruch auf ein allerletztes Werk. Und tatsächlich sollte noch eine unvollendete Zehnte folgen. Dies dann aber als wirklicher Abschied vom Leben, ja eine Botschaft aus dem Jenseits bei dem Mahler dann auch Hilfe aus dem Diesseits brauchte. Diese kam 1960 dann in der Person des Musikwissenschaftlers Deryck Cooke, der die Zehnte vervollständigte. So verwunderte es nicht, wenn Petrenko Mahlers 9. Symphonie mit sehr viel Energie, Lebendigkeit und Licht dirigierte. Vor allem die drei ersten Sätze vermittelten dieses Gefühl eines neuen Aufbruchs, während das wunderbare Schlussadagio dann noch einmal die Gattung Symphonie in schönster Form aufleben ließ.
Was in Petrenkos Interpretation faszinierte, das war die innere Geschlossenheit und das Vermögen, Mahlers Spätwerk in einem anderen, neuen Licht zu zeigen, ohne dabei die Tradition zu verraten. Und dabei wurde es dem Zuhörer an keiner Stelle langweilig. Petrenko gelang das Kunststück, während über 80 Minuten die Spannung hochzuhalten und seine Sicht, seine Konzeption sehr deutlich herauszuarbeiten. Das ging aber auch nur, weil die Berliner Philharmoniker ihrem Chefdirigenten hundertprozentig folgten. Besser kann ein Orchesterspiel nicht sein; selten habe ich dieses Werk so transparent, so vielschichtig und so plausibel erlebt wie an diesem Abend. Sicher, der späte Abbado rührte mich hier mit seinem ergreifenden Humanismus und seiner eigenen Nähe zum Tod zu Tränen, doch Petrenkos zukunftsweisende Interpretation war nicht minder faszinierend. Zumal die Berliner Philharmoniker mit ihrem einmaligen Klang (welches pianissimo in den Streichern zum Schluss des Adagio!) und vor allem einem gemeinsamen Atem dieser Symphonie Leben und Struktur gleichermaßen einzuhauchen vermochten.