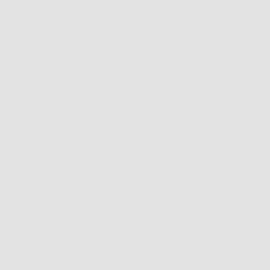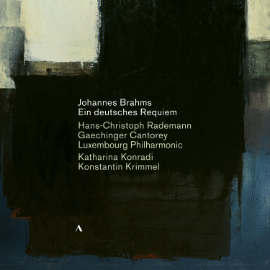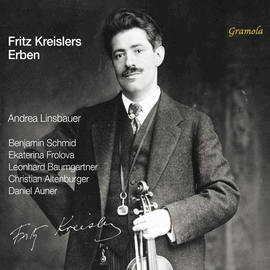Der diesjährige Besuch bei den Bayreuther Festspielen begann für unseren Mitarbeiter Alain Steffen mit einer Aufführung (8. August) von Wagners letztem Werk, dem Parsifal in der Inszenierung von Jay Scheib, die sich die Zerstörung der Erde und den Niedergang der menschlichen Zivilisation zum Thema gemacht hat.
Lithium und seltene Erden sind hier der Gral, ihre Ausbeutung führt folglich zur Naturkatastrophe und damit zum Ende der Menschheit.
Einschläfernde Längen
Scheib macht das in sehr plastischen, aber nie aufdringlichen Bildern klar, und indem er am Ende Parsifal den Gral zerstören lässt, gibt er dem verletzten Mensch Verantwortung und Hoffnung, es vielleicht jetzt anders, besser zu machen. Die Geschichte wird gradlinig erzählt und lebt vor allem von dem exzellenten Sängerensemble, das allerdings, so muss man sagen, so gut wie alleine gelassen wurde. Dirigent Pablo Heras-Casado war nämlich viel zu sehr damit beschäftigt, die Musik puzzleartig auseinanderzunehmen und wieder zusammenzufügen, als dass er sich intensiv am Ablauf des musikalischen Dramas beteiligte. Da gab es zwar sehr viele schöne und ergreifende Momente, aber da gab es leider auch viel zu viel Leerlauf und Langeweile, bei denen man den Eindruck hatte, der Dirigent sei eingeschlafen.

Pablo Heras-Casado
Vor allem litt der 1. Akt unter einer erschreckenden Spannungslosigkeit, so dass die langen Gurnemanz-Erzählungen ihre musikalische Aussagekraft verloren. Georg Zeppenfeld, der wohl beste Gurnemanz der letzten Jahre, interpretierte so auf Sparflamme und blieb hinter seinen gewohnten Leistungen zurück. Der große Michael Volle kümmerte sich erst gar nicht um das Dirigat, sondern sang auf sich gestellt, einen ergreifenden Amfortas.
Im 2. Akt wurde es dann ab der Blumenmädchen-Szene besser. Pablo Heras-Casado schien erwacht und von jetzt an nahm die Oper etwas an Fahrt auf. Andreas Schager als sensationeller Parsifal und Ekatarina Gubanova als ebenso grandiose Kundry ließen den zweiten Akt zu einem Erlebnis werden. Etwas schwach war der Klingsor von Jordan Shanahan. Vor der Blumenmädchenszene dümpelte Heras-Casados Dirigat noch so vor sich hin, so dass er dem Klingsor-Sänger nicht die Unterstützung zukommen ließ, die dieser brauchte. Die Spannung hielt sich dann fast bis zum Schluss des dritten Aktes, allerdings nickte der Dirigent wieder beim Karfreitagszauber ein, so dass auch dieser wunderbare Moment trotz Zeppenfeld und Schager verschenkt wurde.
Der Meister am Pult
Wie wunderbar und schlüssig Wagners Musik trotz ausgefeilter Detailarbeit zu klingen vermag und wie spannend das sein kann, das zeigte uns Christian Thielemann am folgenden Abend mit dem Lohengrin. Unüberhörbar, Thielemann ist in den letzten Jahren als Wagner-Dirigent gewachsen und beherrscht nun Transparenz und Subtilitäten ebenso wie den Pathos und den großen Atem.

Christian Thielemann
(c) Matthias Creutziger
Seinen Sängern legte er einen wunderbaren Orchesterteppich aus und trug sie den ganzen Abend über auf Händen. Diese Vorstellung vom 9. August war die Dernière dieser interessanten, wenn auch nicht unbedingt sehr beliebten Inszenierung von Yuval Sharon aus dem Jahre 2018, der, da er erst später zum Team gestoßen war, seine Arbeit den Bühnenbildern von Neo Rauch und Rosa Loy anpassen musste. Auch hier wird die Geschichte gradlinig und konsequent erzählt. Im Zentrum steht die Menschwerdung von Lohengrin und ihr Scheitern an der Realität und einem unlösbaren Konflikt. Nachdem Piotr Beczala krankheitshalber absagen musste, sprang Klaus-Florian Vogt, der eigentliche Lohengrin-Darsteller dieser Produktion und somit bestens mit der Inszenierung vertraut, kurzfristig für ihn ein. Und wurde am Ende mit Ovationen überschüttet. Erstaunlich wie frisch und lyrisch die Stimme immer noch ist; Vogt hat sich ja bekanntlicherweise in den letzten Jahren vermehr den schweren Partien wie Tannhäuser und Siegfried zugewandt und seine beiden Paradepartien Lohengrin und Stolzing hinter sich gelassen. Leider singt er die Rolle immer gleich, so dass man jeden Akzent und je Linie kennt und seine Interpretation, so toll sie auch sein mag, immer vorhersehbar bleibt.
Ihm zur Seite stand Elza van den Heever als Elsa, deren dramatische Stimme einige Schärfen aufwies und nicht unbedingt für diese doch sehr lyrische Rolle geeignet ist. Mika Kares sang einen kraftstrotzenden Heinrich der Vogler, Michael Kupfer-Radecky einen nur korrekten Heerrufer. Das Paar Ortrud-Telramund war hochkarätig besetzt. Olafur Sigurdarson, der erstaunlicherweise nur bescheidenen Applaus erhielt, sang diese Rolle mit schönem, satten Timbre und verfiel nie ins Schreien. Stattdessen zeigten sein lyrischer Vortrag und sein enorm präziser Gesang, dass diese Figur keine Bestie sondern ein fehlgeleiteter Adliger ist.
Die Krone des Abends aber gehört Miina-Liisa Värelä, die als Ortud mächtig auftrumpfte und das Festspielhaus, wie auch das Publikum zum Beben brachte. Eine derart grandiose Ortrud hat man hier seit langem nicht mehr gehört. Miina-Liisa Värelä wird ein Gewinn für das Festspielensemble werden und man darf nur hoffen, dass man diese Sängerin weiterhin auf der Bayreuther Bühne erleben kann.
Nach dem Chor-Disput und dem Abgang von Eberhard Friedrich hat der abgespeckte Bayreuther Festspielchor nun einen neuen Leiter. Thomas Eitler-de Lint hat es innerhalb kurzer Zeit geschafft, diesem Elitechor ein neues Gesicht zu verleihen. Der Klang hat sich verändert, Farben und Dynamik auch. So macht es wirklich Freude zu hören wie anders, wie neu und wie interessant der Chor unter einem neuen Leiter klingen kann.
Schon im letzten Sommer hatte mir die Neuinszenierung von Tristan und Isolde durch den isländischen Regisseur Thorleifur Örn Arnasson sehr gut gefallen. Seine psychoanalytische Deutung ist schlüssig, was sowohl Handlung wie auch Bühnenbilder betrifft. Überhaupt kann man sich in diesem Jahr in Bayreuth über sehr starke und gelungene Bühnenbilder freuen.
Reise ins Unbewusste
Vieles bei diesem Tristan spielt sich dabei im Unbewussten ab, in einer Traumwelt der Erinnerungen, dargestellt durch den vollbepackten Schiffsrumpf, in dem sich allerlei Artefakte und Symbole aus Tristans und Isoldes Leben befinden. Das Brautkleid der Isolde im 1. Akt ist quasi ein beschriftetes Tagebuch des Leidens. Arnasson begleitet den Hörer auf diese Suche ins tiefe Ich, ohne aber dabei wirkliche Erklärungen abzuliefern. Und das ist auch gewollt, den so kann sich der Zuschauer zusammen mit der Musik in dieses tiefe Dunkel fallen lassen und dabei eine einzigartige Erfahrung machen. Auch hier wird klassisch inszeniert; trotz freudianischer Ansätze kann man die Geschichte ganz präzise verfolgen.

Semyon Bychkov
(c) Petra Hajska
Semyon Bychkov am Pult des hervorragend disponierten Festspielorchesters schaffte magische Momente voller Intensität und Schönheit, aber auch voller Dramatik und auswegloser Tristesse. Die beiden Hauptdarsteller wuchsen an diesem Abend (10. August) über sich heraus. Andreas Schager als Tristan beeindruckte sowohl durch atemberaubende Karftausbrüche wie durch zartesten, leisen Gesang. Kein Zweifel, er ist ‘der’ Heldentenor der Gegenwart und lässt mit seinem Gesang Erinnerungen an einstigen Heldentenöre wie Max Lorenz, Bernd Aldenhoff oder Lauritz Melchior wach werden.
Camilla Nylund als Isolde hat mir deutlich besser gefallen als im Vorjahr; insbesondere im 1. Akt vermochte sie immer wieder über sich herauszuwachsen. Allerdings hätte ihr Gesang gerade im Liebestod etwas runder und lyrischer sein können. Ekatatrine Gubanova war eine Idealbesetzung für die Rolle der Brangäne, darstellerisch wie stimmlich präsent und gesangstechnisch perfekt. Jordan Shanahan besitzt vielleicht keine enorm große Stimme, aber er interpretierte mit Stil und Technik und sang so einen sehr lyrischen und präzisen Kurwenal. Günther Groissböck war ein majestätischer, zutiefst berührender König Marke, der mit seinem volltönenden Gesang und seinem warmen Timbre die Linie der großen Bayreuther Marke-Darsteller weiterführte.
Die Meistersinger als farbenfrohe Komödie
Besonders gespannt war man in diesem Jahr auf die Neuiszenierung der Meistersinger von Nürnberg, Wagners einziger komischer Oper. Nach den beiden politischen Deutungen durch Kataharina Wagner und Barrie Kosky wollte man diesmal den komödiantischen Aspekt im Mittelpunkt haben. Die Meistersinger als Komödie, als Volksstück voller Farben und skurriler Charaktere. Dafür hatte man jetzt den Musical-Regisseur Matthias Davids nach Bayreuth geholt und der lieferte eine tolle Arbeit ab. Schon im ersten Jahr kann man sagen, dass diese Produktion mit ihren phantasievollen Bühnenbildern (Andrew D. Edwards) und Kostümen (Susanne Hubrich) Kultcharakter hat. Davids nimmt den Humor und die Botschaften sehr ernst und wird bei seiner Auslegung eigentlich nie plakativ. Der Zuschauer sieht keinen peinlichen Unsinn oder neuerfundene Besserwisserei, nein, er erlebt die Meistersinger als eine zutiefst humane Oper mit liebenswerten, ja oft kindischen Charakteren. Die Meister sind ein Haufen Freunde, die sich mehr auf das Buffet freuen, als dass sie große Lust hätten, den pathetischen Ausschweifungen Pogners zuzuhören. Die Volkswiese ist ein Fest, bei dem Menschen aller Schichten willkommen sind. Davids Humor ist wohldosiert und spart ernste Momente, wie die Schusterstube im 3. Akt nicht aus. Gerade hier kommt er auf den Punkt und zeigt dass in eine Komödie Lustspiel und tiefer Ernst durchaus nebeneinander existieren können.

(c) Enrico Nawrath
Ein spielfreudiges Ensemble machte den Abend zu einem Hochgenuss. Georg Zeppenfeld als grandioser Sachs, Michael Nagy als sein sympathischer Kontrahent und Freund Sixtus Beckmesser, Jongmin Park als stimmgewaltiger, konservativer Pogner, Jordan Shanahan als Kothner und vor allem Christina Nillson als atemberaubende Eva führten die Riege exzellenter Darsteller an. Mit dem Stolzing von Michael Spyres konnte ich mich dagegen an keinem Moment anfreunden. Seine Stimme wirkte belegt, sein Vortrag langweilig und seine Stimmführung nach oben hin doch sehr eng. Wenn er auch das Durchhaltevermögen und den langen Atem für das Preislied besitzt, so fehlte es der Stimme an Glanz und Schönheit.
Christa Mayer war eine überzeugende Magdalena, Matthias Stier ein stimmpotenter, heldenhafter David mit einigen Unsauberkeiten und Tobias Kehrer ein prächtiger Nachtwächter.
Daniele Gatti entschiedt sich für bedächtige Tempi, was eigentlich nur in der der etwas breiig interpretierten Ouvertüre störte. Ansonsten gewährte er tiefe Einblicke in das musikalische Geschehen und erlaubte es dem Hörer immer wieder, diese Partitur ganz neu zu hören. Die Sänger profitierten von Gattis umsichtigem Dirigat und konnten sich in jedem Moment auf ein sicheres Orchesterspiel verlassen. Last but not least war es die wunderbare Chorarbeit, die das Sahnehäubchen des dritten Aktes ist und das Publikum zu wahren Beifallsstürmen hinriss.