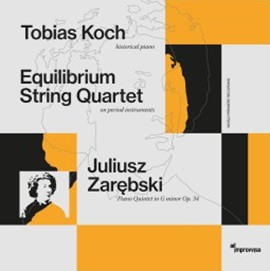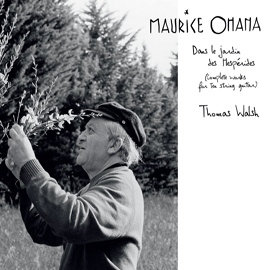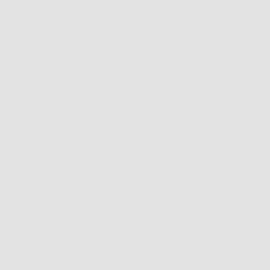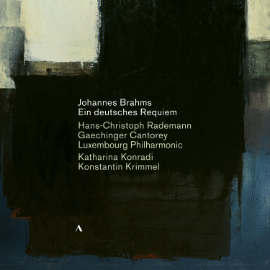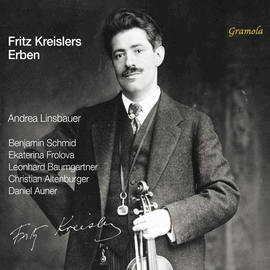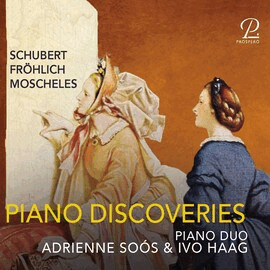Herr Hoffmeister, Sie arbeiten seit Jahrzehnten für diverse Klassik-Medien. Was ging in Ihnen vor, als man Sie darum bat, für die Stiftung ‘Zukunft Gewandhaus zu Leipzig Projekte GmbH’ ein Radio im Namen des Gewandhauses aufzubauen?
Wenn man über 40 Jahre hinweg in unterschiedlichen Bereichen der Medienlandschaft, im Print- und Online-Segment, ebenso wie bei TV-Anbietern und Radios in verschiedenen Formaten tätig war, insbesondere aber die Neugründung von mehreren Kultur- und Klassikprogrammen begleitet hat, dann ist man natürlich positiv gestimmt gegenüber einer Option wie dieser, gleichzeitig verspürt man jedoch auch Demut und Respekt. Zum einen vor der Institution Gewandhaus, zum anderen vor der Herkulesaufgabe, den vielfältigen Herausforderungen des Projektes gerecht werden zu können. Denn der Zeitaufwand bei relativ geringer Vorlaufphase ist beträchtlich. Grundsätzlich hilft die langjährige Erfahrung dabei, die Dinge realistisch einzuschätzen.
Welche Aspekte waren ausschlaggebend dafür, das Projekt in die Hand zu nehmen?
Fraglos die vorbehaltslose Passion für das Sujet. Die Leidenschaft für die Klassik begleitet mich aktiv seit dem 13. Lebensjahr. Sie hat verschiedene Metamorphosen durchlaufen, sie hat sich in unterschiedlichen Aktivitäten gezeigt, die Emphase aber blieb stets auf gleichem Niveau. Im Vordergrund stand dennoch die Frage, ob das vorgesehene programmatische, ästhetische und strukturelle Konzept des Gewandhaus Radio nur Redundanz erzeugen würde, oder ob trotz eingeschränkter personeller und finanzieller Ressourcen substantielle Ergänzungen zu den anderen Playern entstehen könnten. Am Ende überwog der Eindruck, dass vor allem im Repertoirebereich für Ergänzungen resp. Weiterungen durchaus noch Raum ist.
Zumindest in Deutschland stehen die öffentlich-rechtlichen Klassik- und Kulturwellen vor zahllosen grundsätzlichen Veränderungen. Einige der Kulturwellen haben ihr Klassik-Angebot deutlich ausgedünnt, die Zahl der einschlägigen Angebote schrumpfte zudem qualitativ und quantitativ. War es vor diesem Hintergrund nur eine Frage der Zeit, bis private Initiativen auf die Agenda treten?
Ich sehe keinen Zusammenhang, eher eine zufällige, vielleicht auch willkommene Koinzidenz. Zwar würde ich zustimmen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für neue Klassikradio-Angebote ist, aber Verfasstheit und Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dürften nicht der Grund für die Initiative gewesen sein.
Im digitalen Zeitalter sind Radioprogramme grundsätzlich weltweit zu empfangen. Für jeden einzelnen Anbieter verdichtet sich damit die Konkurrenzsituation. Überwiegen vor diesem Hintergrund eher Gefahren oder Chancen des Projektes?
Um die Frage sinnstiftend beantworten zu können, gilt es, etwas weiter auszuholen. Grundsätzlich: Trotz wissenschaftlicher und statistischer Erhebungen und einschlägiger Publikums- und Hörerbefragungen, wird Ihnen niemand seriös voraussagen können, wie sich Wahrnehmung und Akzeptanz von Klassikradio-Programmen entwickeln werden. Insbesondere die nachwachsenden Generationen lassen sich kaum mehr festlegen, sie entscheiden situativ resp. spontan darüber, wem oder was ihre Wahrnehmung gilt. Damit müssen insbesondere aufmerksamkeitsintensive Kultur- und Klassikanbieter leben. Eine fatale Rolle in diesem Zusammenhang spielt zunehmend auch die von Zeitgeist und Moden geprägte gesellschaftliche Gruppendynamik. Der Druck gegenüber Minderheitenangeboten und komplexeren Inhalten wächst täglich. Andererseits generieren volatile Zeiten die Sehnsucht nach Werten und stabilen Bezugspunkten. Der Dichter Hölderlin hat solche indifferenten Ausgangslagen unübertroffen auf den Punkt gebracht: « Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch ».
Ihren Worten ist eher Zuversicht zu entnehmen…
Klassik zählt zu den wesentlichen Grundpfeilern der globalen Kultur, sie ist zentraler Bestandteil kultureller Identität. Sie trägt zur emotionalen und mentalen Verfeinerung bei, stärkt das analytische Denken und die Aufmerksamkeitspotentiale. Das zu erhalten oder zumindest dazu beizutragen, das zu erhalten, bleibt das Ziel. Starke Marken wie Gewandhaus und Gewandhausorchester helfen natürlich enorm bei der Verbreitung dieser Idee.
Wie konkret kann das Gewandhaus Radio die Institutionen Gewandhaus und Gewandhausorchester stärken?
Das klassikaffine Publikum verbindet mit diesen Institutionen insbesondere die starke, einmalige Tradition und die damit konnotierten legendären Dirigenten- und Komponisten-Persönlichkeiten. Überdies spieltechnische Exzellenz, originäre Exegesen und die spezifische Klangkultur. Zusammengenommen generieren diese Aspekte nicht nur eine eminente Strahlkraft, sondern auch einen spezifischen Geist. Den gilt es entlang des Radioprojektes zu spiegeln.
Worin besteht der unmittelbare Gewinn des Radios für Gewandhaus und Gewandhausorchester?
Jedes Orchester mit zeitgemäßem und professionellem Marketing-Apparat muss sich heute etwas einfallen lassen, um das Publikum, insbesondere die Abonnenten gewogen zu stimmen. Selbst für Klassikaffine ist es nicht mehr selbstverständlich, jedes Konzert zu besuchen oder ein Abonnement zu kaufen. Zudem kommt man mit den meisten traditionellen Werbemethoden vor allem beim jüngeren Publikum kaum weiter. Es gilt, im digitalen Raum mit einem vielfältigen Angebots- und Informationstableau präsent zu sein. Für die Marketing-Aktivitäten mit Hilfe einer Stiftung auch ein Radio im Portefeuille zu haben, könnte ein weiteres substantielles Element erfolgreicher Werbestrategie darstellen. Was es abzuwarten gilt. Fest steht bereits jetzt, dass das Ding an sich, ein Radio im Namen eines international renommierten Konzerthauses und Orchesters, als medienpolitisches Solitär mit entsprechender Wirkkraft fungiert. Allein die Existenz des Radios zahlt auf die Marke Gewandhaus ein.
Klassik- und Kulturwellen sind Nischenprodukte, die durchschnittlich minus/plus 2 – 3 Prozent der Weltbevölkerung erreichen. Welche Rolle spielt das Thema Konkurrenz unter den einschlägigen Programmen?
Ich halte die Konkurrenz-Diskussion in diesem wie in den meisten anderen Kultursegmenten für obsolet und destruktiv. Was Klassikwellen angeht: Jeder Betreiber weiß, dass mit diesem Genre, ebenso wie mit Jazz, kein Geld zu verdienen und nur eine begrenzte Anzahl von Menschen zu erreichen ist. Man bringt entsprechend Klassikwellen auf den Weg, um das Sujet zu stärken und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Es geht immerhin um einen gewichtigen Teil des Weltkulturerbes. All das bestärkt mich darin, nicht in Konkurrenz-Kategorien zu denken oder zu argumentieren, eher jedes einzelne Programm als Ergänzung zu den anderen zu begreifen.
Gerade ein Radio mit geringem Personaltableau und überschaubaren Finanzressourcen bedarf neben konsistenter Grundidee und Strukturen optimale technische Rahmenbedingungen und die Unterstützung der einschlägigen Klassiklabels weltweit…
An Unterstützung von Seite der Labels mangelt es nicht. Im Gegenteil. Und man muss auch immer wieder betonen, dass ohne die hochkarätigen Produktionen engagierter Firmen Radios mit Musik-Anteilen nicht denkbar wären. Auch die Streaming-Portale leben vom opulenten Tonträgerkatalog. Ohne diesen Fundus, den wenige Bibliotheken, Privatsammlungen und Vertriebe noch vorhalten, wäre ein ganzer Klassik-Kosmos dem Vergessen preisgegeben. Nicht zuletzt hilft die kontinuierliche Beschäftigung mit diesem Universum, konsistente, verifizierbare Maßstäbe zu entwickeln für die Beurteilung von Klassik und Klassik-Tonträgern. Was die Archive und Label-Backlists lehren, kann weder ein Musik- oder Musikwissenschaftsstudium, noch regelmäßiger Konzert- oder Opernbesuch leisten und kompensieren.
Das Radio genießt seit Jahrzehnten hohe Akzeptanz und wird insbesondere in der Altersgruppe ab 50 täglich oder regelmäßig genutzt. Seit der globalen Erschließung der digitalen Räume befindet sich das Medium allerdings beispielsweise durch Soziale Netzwerke, Podcasts oder Streamingportale in einer verdichteten Konkurrenzsituation. Besonders im Musiksegment schließen die Streamingportale auf oder dominieren bereits die Märkte. Auch Klassikaffine nutzen mittlerweile mit Hinweis auf leichte Bedienbarkeit Playlists und Zugriff auf hunderttausende von Titeln solche Portale. Wie reagiert man als Radio-Anbieter auf diese Alternativ-Optionen?
Medien und Streamingportal-User sprechen ja gerne von den Potentialen der sogenannten Individualisierung von Musikwahrnehmung und Musikgeschmack, die das Streaming unterstütze und ermögliche. Das irritiert, da Musikgenuss mit der Etablierung von riesigen Tonträgerkatalogen, also spätestens seit den 60-er Jahren, immer schon zu den individuellsten Angelegenheiten der Privatsphäre gehörte. Und eigene Playlists hat sich in seiner Jugend ebenfalls fast jeder Heranwachsende zusammengestellt, nur eben auf umständlichere Art und Weise. Nicht von der Hand zu weisen sind natürlich die Vorteile digitaler Verfügbarkeit von Titeln und Alben, die die Portale umfassend zur Verfügung stellen. Umfassend, aber nicht erschöpfend, muss man ergänzen, denn die Potentiale der Kataloge der Tonträgerindustrie finden sich nur eingeschränkt abgebildet. Bedeutende Nischen-Alben und vieles aus den ersten Jahrzehnten der Tonträgergeschichte fehlen.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten war in den Print-Medien immer wieder von einer ‘Krise der Klassik’ zu lesen…
…die Medien lieben nichts mehr als Krisen. Was eine Wirtschafts-, Energie- oder Bildungskrise ist, kann ich nachvollziehen. Aber was soll eine Krise der Klassik sein? Eine Krise von Beethovens 9. Symphonie, eine Krise der Barockmusik, eine Krise der Chormusik. Stellen Sie sich vor, man spräche von einer Krise der Malerei. Was kriselte denn: Etwa die Gemälde von Turner, Velasquez oder Monet? Die semantische Indifferenz, entlang derer der Klassik eine Krise unterstellt wird, zieht sich durch den gesamten Diskurs. Beim Leser bleibt hängen, Klassik sei anachronistisch, nicht mehr relevant, unbeliebt und daher überflüssig. Die ‘Krise der Klassik’ war aber niemals und bis heute keine Krise des Genres, sie war und ist allenfalls eine Krise derer, die mit Klassik Geld verdienen: CD-Labels, Konzert- und Opernhäuser, Magazine, Agenturen, Veranstalter etc.. Das aber sind komplett andere Sachverhalte, die unabhängig von der Akzeptanz-Frage erörtert werden müssen. Wenn die Freizeitoptionen zunehmen, der Alltag sich zunehmend ins Netz verlagert, Gewohnheiten sich neuen Jobstrukturen anpassen müssen, und die Hörgewohnheiten Änderungen unterworfen sind, dann sollte man sich über Auswirkungen auf den Umgang mit Klassik nicht wundern. Hinzu kommt: Offensichtlich sinkt bei manchem Verantwortlichen das Vertrauen in komplexere Kunstformen wie die Klassik. Nur mehr als Lifestyle-Accessoire, vernimmt man, habe sie, wenn überhaupt, eine Zukunft. Dabei ist sie doch in Reinform so viel mehr: In endlosen Ausfaltungen Fluchtpunkt und Korrektiv zu den Zumutungen des Alltags und ewiges Paradigma vergangener Geistespotentiale.