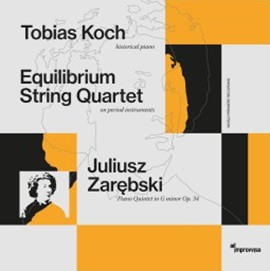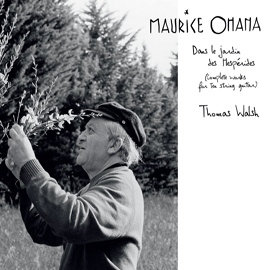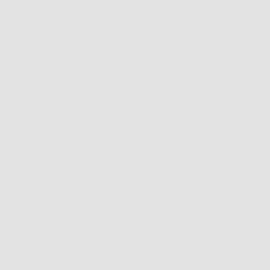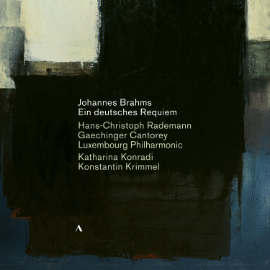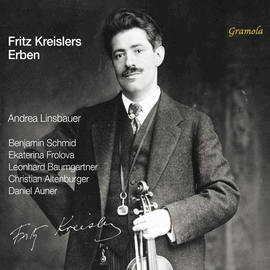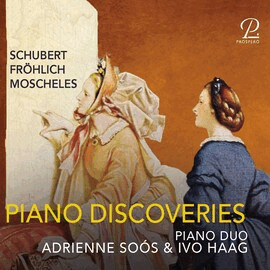Vor 20 Jahren, am 26. Juni 2005 wurde die Philharmonie in Luxemburg eröffnet. Pizzicato berichtete unter dem Titel: Ein Saal der Superlative. Hier ist was damals (noch in der Printausgabe) veröffentlicht wurde.
Am Sonntag, dem 26. Juni war es endlich soweit: Die lang ersehnte Philharmonie wurde offiziell eröffnet. Es ist ein Saal der Superlative geworden, über den sich die ausländische Presse zu Recht begeistert zeigt. « Luxemburg erhielt den Saal den Paris sich wünschte », titelte der Reporter von Musical America! Ja, Christian de Portzamparc hat für Luxemburg eine Top-Architektur entworfen, ohne jeden Zweifel einen der schönsten und ästhetischsten Konzertsäle der Welt. Albert Xu und sein Mitarbeiter Damien Dupouy haben eine Akustik hingezaubert, die zum Natürlichsten und Feinsten gehört, was unsere Ohren je gehört haben. Dass es in der Planung des Saales von der praktischen Seite gesehen einige gravierende Fehler gegeben hat, wiegt umso schwerer…Remy Franck und Alain Steffen berichten über die Eröffnung des nationalen Konzerthauses.
Mathias Naske und sein Team wollten sofort zu Beginn neue Weichen stellen und sich von dem allgemein üblichen Eröffnungszeremoniell distanzieren. Sie gaben mit Opening fanfare I & II über dreihundert jungen Musikern der UGDA die Gelegenheit, eigens für diesen Anlass komponierte Werke für Bläser zur Aufführung zu bringen. Um 14.00 sowie um 16.00 Uhr hatten sich 246 Musiker zwischen die Säulen im Foyer platziert, um dort Renald Deppes Komposition Tempus Fugit – Windvariable Klanginstallation für 230 standfeste Flöten und Klarinetten nebst 4 X 4 sitzstarken Blechblasmusikanten in zwei unterhaltsamen Teilen, zu spielen. Danach wurden im großen Auditorium Marcel Wenglers ‘…in den Himmel wachsen’ (Opening fanfare I) und Renald Deppes ‘Sturcedur – Eintausendachthundertzweiundzwanzig op. 124-Variationen über kein Thema von L. van Beethoven’ (Opening fanfare II) gespielt. Beides waren Werke für sinfonisches Blasorchester, wobei Wenglers Komposition recht virtuos mit diesem Begriff umgeht und eher klassisches Ambiente verbreitet. Einflüsse von Berlioz und Wagner waren nicht zu überhören, vielleicht sogar gewollt. Neben diesem kunstvollen, aber auch spielerischen Verflechten vieler kompositorischer Möglichkeiten für Blasorchester ließ Wengler es sich am Schluss nicht nehmen, sein Werk mit so richtig deftiger luxemburgischer Marschmusik zu Ende zu bringen. Dass sinfonische Blasmusik aber auch im modernen Repertoire seinen Weg sucht, das bewies Deppes experimentelles Stück Sturcedur.
Abends fand die festliche Eröffnung mit der Welturaufführung von Krzysztof Pendereckis 8. Symphonie statt, einem Auftragswerk, das speziell für diesen Anlass komponiert worden war. Pendereckis Symphonie ‘Lieder der Vergänglichkeit’ setzt sich aus Liedern zusammen, deren Texte von Lyrikern wie Hesse, Kraus, Goethe oder Eichendorff stammen und die sich alle um das Thema Baum und Natur drehen. Die knapp 40 Minuten dauernde Symphonie ist für Sinfonieorchester, Sopran, Mezzosopran, Bariton und Chor geschrieben und reiht sich mit ihrer moderat-modernen und sehr lyrischen Sprache in die Reihe großer symphonischer Liedkompositionen wie Les Nuits d’Eté von Berlioz, Mahlers Lied von der Erde, aber auch Schönbergs Gurre-Lieder ein, ohne allerdings deren Niveau zu erreichen. Die Achte ist eine durch und durch lyrische Symphonie, lässt aber an keiner Stelle beim Zuhörer einen Aha-Effekt aufkommen. Penderecki bleibt in seinem kompositorischen Schaffen hier sehr bescheiden, viel zu bescheiden möchte man fast sagen. Abgesehen von einigen wunderbar auskomponierten Momenten, besonders in den beiden letzten Liedern, nimmt das Werk einen nie wirklich gefangen. Eher bedächtig plätschert es dahin, ohne wirklich Stellung zu beziehen.
Die Interpretation war aber vom Feinsten. Obwohl das Notenmaterial relativ spät eingetroffen war, konnten sich Bramwell Tovey und das Orchestre Philharmonique du Luxembourg doch gut vorbereiten. Dank der hervorragenden Akustik des Raumes konnte sich das Werk wirklich hundertprozentig entwickeln. Alle Pulte zeigten sich in Bestform. Die drei Solisten Olga Pasichnyk, Sopran, Agnieszka Rehlis, Mezzosopran, und Wojtek Drabowicz, Bariton waren exzellent und boten hervorragende gesangliche Leistungen, die dem geschriebenen Wort dazu die nötige Substanz verliehen. Eine sehr gute Figur machte auch die EuropaChorAkademie (Leitung: Joshard Daus), ohne allerdings durch die kompositorischen Umstände wirklich gefordert zu werden.
Bramwell Tovey dirigierte umsichtig und war sehr um die diversen Stimmungen bemüht. Er kam sehr gut mit der Akustik zurecht, so dass jedes der Lieder mit einer spezifischen Atmosphäre aufgewertet wurde. Darüber hinaus sorgte Tovey für eine intensive Interpretation und ein transparentes sowie filigranes Orchesterspiel, das Pendereckis Sinfonie sehr entgegen kam und voll und ganz dem lyrischen Charakter entsprach.
Zwei Tage später überraschte das neu gegründete Orchestre National de Jazz du Luxembourg. Gast Waltzing und seine sechzehn Musiker nutzten die Gunst der Stunde und boten dem Publikum ein glanzvolles Konzerterlebnis. Der Pianist George Duke fügte sich nahtlos in das luxemburgische Jazzorchester ein und versuchte nie, sich in den Vordergrund zu spielen. Somit war das Konzert bestens ausbalanciert und gab vielen jungen Musikern die Gelegenheit zu Soloeinlagen. Ob in den Tutti oder den Soli, man war von dem spielerischen Niveau der Musiker einfach begeistert. Neben sieben hochkarätigen Kompositionen von Gast Waltzing und zwei von George Duke, hatten aber auch David Laborier, Gitarre, und Marc Mangen, Keyboards, diesmal die Gelegenheit, je eine Eigenkomposition vorzustellen. Sowohl Laborier wie auch Mangen sprechen jeder für sich eine sehr individuelle und sehr rhythmische, mitreißende und phantasievolle Jazz-Sprache, die jedes Mal vom Publikum mit lang anhaltenden Applaus aufgenommen wurde. Auch hier beeindruckte das Können der Musiker und bewies, dass die einheimische Jazz-Szene erstklassige Interpreten und Komponisten hat, die einen Vergleich mit ausländischen Kollegen nicht zu scheuen brauchen.
Neben Berlin und Wien ist London eine der wenigen Städte weltweit, die über mehrere Orchester von Weltniveau verfügen. Eines davon, das London Philharmonic, gastierte im Rahmen der feierlichen Eröffnungswoche in der Philharmonie und zwar mit dem Violinkonzert von Peter Tschaikowsky und der 8. Symphonie von Antonin Dvorak. Darüber hinaus erwarteten wir natürlich mit Spannung die Uraufführung des Auftragswerkes Traumblende von Camille Kerger, einem der interessantesten und vielseitigsten Luxemburger Komponisten.
In dem er eine quasi endlose Melodie benutzt, spannt der Komponist einen großen Bogen der Tradition zwischen der spätromantischen Musik des frühen 20. Jahrhunderts und der Musik von heute. Wie losgelöst erscheinen im Mittelteil, gewollt oder ungewollt, Anklänge an das Adagio aus Mahlers 10. Sinfonie, deren Vollendung man bestenfalls nur erträumen kann. Kerger setzt diese postromantische Struktur wie einen Fels ins Zentrum, zu dem der Anfang hinführt und von dem sich der Schluss wieder entfernt. Anfang und Ende begegnen sich im Raum, ihre Verbindung zu einander scheint reell, logisch, kann aber vom Hörer ebenfalls nur in der Phantasie nachvollzogen werden. Die Musik als Kreis, als immer wiederkehrende Parabel? Kann eine Musik, die so gradlinig ist, zu einem Kreis werden? Kergers Tonsprache ist konsequent, lässt dem Hörer aber genügend Freiraum zum Mitfühlen, zum Mitdenken. Traumblende ist ein Werk, das Aufmerksamkeit verdient, zumal sich Camille Kerger hier als exzellenter Techniker behauptet, der es versteht, sich das Potential eines Sinfonieorchesters für seine Klangwelten zu eigen zu machen.
Das Ereignis des Abends aber erlebten wir mit dem Violinkonzert von Peter Tchaikovsky. Julia Fischer spielte dieses Violinkonzert in einer absolut phänomenalen Interpretation. Nicht das virtuose Element stand im Mittelpunkt, mit feinfühligem Sinn und einem klaren Konzept spielte Fischer das Konzert wie Kammermusik. Jeder Melodie wurde nachgespürt und alle Klischees, die man von diesem Werk kennt, wurden unter Julia Fischers Fingern zu einer sensationellen Neuentdeckung. Da gab es keine Routine, sondern nur Ehrlichkeit. Die Solistin gab den Noten wieder einen Sinn, Noten, die durch zu viele effekthascherische, plakative oder nur routinierte Aufführungen ihren wirklichen Wert verloren hatten.
Der Dirigent des London Philharmonic Orchestra war Emmanuel Krivine, Erster Gastdirigent des Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Krivine, das bewies er an jenem Abend aufs Neue, ist ein Dirigent von Weltformat. Die Sorgfalt, mit der er z.B. Kergers Werk anging, die Aufmerksamkeit, mit der er Julia Fischer begleitete und das Talent, auch orchestral aus Tschaikowskys Violinkonzert alles heraus zu holen, was möglich ist. Anstatt die Musik mit dem dicken Pinselstrich aufzutragen, folgte er Julia Fischer in ihrem kammermusikalischen Konzept und bewirkte mit seinem umsichtigen Dirigat wirklich Wunder. Mit dem London Philharmonic Orchestra stand ihm ein Klangkörper zur Verfügung, der keine technischen Grenzen zu kennen schien. Neben technischem Know-how war der Wille zur Interpretation, zum Mitgestalten in jeder Note hörbar. Mit Begeisterung folgten die Musiker Krivine auch in seiner spannenden Auslegung der 8. Sinfonie von Antonin Dvorak, die ich, das muss ich ehrlich zugeben, selbst unter anderen großen Dirigenten selten so packend und farbenreich gehört habe. Krivine schaffte das Kunststück, allen überflüssigen Ballast abzuwerfen und Dvoraks Musik trotz eines zum Teil sehr mächtigen Blechapparates, sehr fein und nervös ausspielen zu lassen. Die Dynamik spielte dabei eine wichtige Rolle, so dass auch diese Dimension Krivines Interpretation noch bereicherte.
Auch die Solistes Européens Luxembourg spielten in der Eröffnungswoche in der neuen Philharmonie. Bei dieser Gelegenheit überreichte Jacques Santer dem Gründer und Leiter des Orchesters, Jack-Martin Händler, den ‘Ordre du Mérite Européen’ für seine Verdienste um eine friedliche Völkerverständigung und für seinen unermüdlichen Einsatz für die europäische Idee. In seiner Rede warnte Händler vor nationalistischem Denken und gab zu bedenken, dass man die europäische Idee der Wiedervereinigung nur mit Humanismus und Toleranz vorantreiben könnte, dass diese Idee des Zusammenwachsens weit mehr ist als ein politisches Ränkespiel. Hier gehe es in erster Linie um Menschen, um eine gemeinsame europäische Kultur und um einen gemeinsamen europäischen Glauben. Ein Teil dieser gemeinsamen Kultur sei die Musik, eine universelle Sprache, die für kurze Momente die verschiedensten Menschen zu einem gemeinsamen Erleben vereine.
In der Philharmonie geschah dies durch die Musik von Josef Haydn, einem vielgereisten Europäer. Das Konzert begann mit der Symphonie Nr. 49 ‘La Passione’. Händler hatte seine Musiker gut im Griff und diese wiederum hatten keine Schwierigkeiten, die akustischen Vorzüge des Saales für ihre Interpretation zu nutzen. Die Instrumente klangen schwebend und sehr homogen. So erlebten wir eine wunderbar leichte, aber immer sehr präzise Interpretation, in der es sehr viel um Schönheit ging.
Die darauf folgende Missa Cellensis, auch Cäcilien-Messe genannt, wurde ins gleiche Licht gerückt. Zurückhaltung, Besinnung, Freude, Transzendenz: Nahezu alle möglichen Facetten des Werkes wurden ausgeleuchtet und trotzdem, war es etwas anderes, kaum greifbares, was diese Interpretation irgendwie einzigartig machte. Vielleicht ist Demut das richtige Wort, um all das zu erfassen, was die Musiker an diesem Abend empfanden und auf die Zuhörer übertrugen. Das Sängerquartett wurde von der überragenden Sopranistin Sibylla Rubens angeführt, die mit ihrem empathischen Gesang und ihren warmen, fast anschmiegsamen Timbre eine ideale Interpretin war. Aber auch die übrigen Protagonisten ließen kaum etwas zu wünschen übrig. Elisabeth Kulman, Mezzo, Steve Davislim, Tenor und Adrian Eröd leisteten alle vorzügliche Arbeit. Sowohl der Städtische Chor Bratislava wie auch der Kammerchor des Luxemburger Konservatoriums sangen auf Topniveau und mit soviel Hingabe und Präzision, dass ihnen unsere besondere Hochachtung gebührt. Auch hier spielten die Solistes Européens auf bestem Niveau
Ein Konzert mit zeitgenössischer Musik unter dem Titel ‘Im Garten der Klänge’ beschloss das Eröffnungsprogramm der Philharmonie. Mit Werken von Charles Ives, Bruno Maderna, Gérard Grisey, György Ligeti, Claude Lenners und Alexander Müllenbach wurde eine internationale Palette an modernen und zeitgenössischen Tönen und Klängen vbon zwei Ensembles präsentiert, dem Klangforum Wien und United Instruments of Lucilin, dem luxemburgischen Ensemble für zeitgenössische Musik. Die Leitung hatte Sylvain Cambreling. Dass dieses Konzert zu einem vollen Erfolg wurde, war auch diesen Interpreten zu verdanken, die mit bewundernswerter Natürlichkeit an die zeitgenössische Musik herangehen und sie mit einer Selbstverständlichkeit spielen, wie andere Ensembles Mozart oder Beethoven.
Neben dem Musikalischen, das begeistertem, gab es Praktisches, was nicht gefiel. So das hier: Inakzeptabel: 300 schlechte Plätze!
Die Dame war den Tränen nahe: « Ich hatte mich so gefreut auf diesen Abend, es lag mir so viel daran, beim ersten richtigen Konzert in der Philharmonie dabei zu sein, und nun das! » Sie wolle ja nicht leichtfertig kritisieren, aber schließlich sei das Haus mit Steuergeldern gebaut worden, und das mache die Sache nur noch schlimmer… Die Rede war von den Plätzen in den Portzamparcs Logentürmen, mit denen er das Parterre umgibt wie einen italienischen Platz. So weit so gut, optisch ist der Effekt beeindruckend, ja eigentlich sogar umwerfend schön und reizvoll… so lange Sie gemütlich in Ihrem Fauteuil in eben diesem Parterre sitzen und die Logentürme von unten bewundern können. Doch wenn Sie zu den Unglücksraben gehören, die einen Platz in den Türmen haben, ist es mit der Bewunderung schnell vorbei. Da ist zunächst ganz banal jeder Sitzkomfort, der fehlt: Hier hat entweder ein kleiner Franzose oder ein Japaner Maß genommen. Die Logen sind entsetzlich eng und jeder normal gewachsene Mensch wird sich da unwohl fühlen, wo er keine Beinfreiheit hat und wo die Sitze so gerade stehen wie Kerzen in der Kirche (nur, dass die mehr Raum um sich herum haben). Dasselbe gilt übrigens für die Kategorie Fauteuil de tours, die Sitzplätze unmittelbar unter den Logentürmen.
Doch es kommt noch schlimmer: irgendwann muss jemand gemerkt haben, dass vor den Sitzen zu wenig Platz ist und deshalb wurden sie etwas höher angesetzt als üblich, damit der nach vorne fehlende Platz nach unten ausgeglichen werden kann. Doch auch das war nicht überlegt. Denn die Dame, die sich bei uns so sehr beklagte, war nicht gerade groß und sie saß in ihrem Sitz wie ein kleines Kind, mit baumelnden Beinen, weil ihre Füße nicht bis an den Boden reichten…. So geschehen in Luxemburg, einem wie man sagt, modernen Staat, in einem gerade eröffneten Konzertsaal von fast 120 Millionen Euro, am 27. Juni 2005.
Dass diese Folter-Stühle nicht, wie in den meisten Sälen üblich, gegen die Bühne angewinkelt stehen, sondern rechtwinklig, ist ein weiterer Knackpunkt und der Grund für so manchen steifen Hals…
Doch es kommt noch dicker: die Beinfreiheit ist eine Sache, die gläsernen Platten, die Herr Portzamparc den Zuhörern mit ihren gequetschten oder baumelnden Beinen vor die Nase hat bauen lassen, sind ein weiterer Minuspunkt der Logen in der viel bewunderten Philharmonie.
Wenn ich ein Orchester durch eine Glasplatte sehen will, setze ich mich vor den Fernseher! Einige Leute sagten mir, sie hätten den Eindruck, die Glasplatten hielten Klang ab. Das mag sein, ich kann es aber nicht ganz nachvollziehen. Die Akustik im Logenturm C empfand ich als durchaus gut und ausgewogen. Aber die ca. 40 cm breite Glasplatte mit den vielen Licht-Reflektionen, Fingerabdrücken und Metall-Fixationen störte mich doch sehr! Etwa zwei Drittel des Orchesters, Dirigent inklusive, musste ich durch dieses horizontale Fenster sehen, mit allen daraus erwachsenden Nachteilen. Wer so etwas plant und baut ist ein Trottel! Und dass es vom Reißblatt bis zur praktischen Anwendung durchgezogen wird, ist nur ein Beispiel mehr dafür, wie sehr sich Architektur-Diven wie Portzamparc – wie genial sie auch in ihrer Kreativität sonst sein mögen – in der Praxis total verrennen können und zudem in ihrer Autokratie umgeben sind von Beratern, die eher in die Hose machen würden als am Meister Kritik zu üben.
Das Resultat ist, dass die Philharmonie mit ihren in normaler Bestuhlung etwas mehr als 1.200 Plätzen deren 300 hat, die in höchstem Masse unkomfortabel sind. Das ist ein Viertel der Kapazität! Ich halte diesen Umstand für einen regelrechten Skandal und sehe es als einen festen Schlag ins Gesicht derer an, die dieses Haus betreiben müssen. Matthias Naske und auch die anderen Veranstalter der Philharmonie haben das nicht nur nicht verdient, ich finde, sie sollten es sich nicht bieten lassen.
Schlecht sitzen, schlecht sehen… ich gelobe es hiermit feierlich: mich bekommt niemand mehr in einen Logenturm!
Parkplatz-Probleme, oder: Pesch gehabt!
In der Stadt Luxemburg ist man die tollsten (d.h. abstrusesten) Verkehrsplanungen zwar gewöhnt, aber was mit dem Bau des Parkhauses an der Philharmonie erreicht wurde, überschreitet alles bisher Dagewesene! Autoschlangen von vielen Hundert Metern bei der Einfahrt ins Parkhaus und entsprechende Verspätungen beim Konzertbeginn, inakzeptabel lange Wartezeiten bei der Ausfahrt: Es ist genau das eingetroffen, was ich in einem Leitartikel bereits als Befürchtung zum Ausdruck brachte. Wie viele Leute bis dato « Leider hatten Sie Recht! » zu mir sagten, weiß ich nicht. Es sind jedenfalls unzählige. « Ja », antwortete ich ihnen, « da haben wir wieder einmal Pesch gehabt! »(Der Name bezieht sich auf den Verantwortlichen der Raumplanung im Luxemburger Viertel Kirchberg)
Planung und Bau dieses Parkhauses sind ein Skandal! Wer bei einem Konzertsaal mit 1.500 Plätzen nicht berücksichtigt, dass innerhalb einer halben Stunde zwischen 600 und 800 Autos in diese Parkgarage fahren müssen, ist ein Schwachkopf wie er im Buche steht! Und wer mir antwortet, die Luxemburger müssten dann halt ihre Gewohnheiten ändern und bereits um 18 Uhr anfahren, um rechtzeitig zum Konzert zu kommen, hält die Leute wohl für so dumm wie er selber ist.
Ich habe mir vom Betreiber des Parkhauses erklären lassen, dass es unmöglich sei, mehr als 5 Autos pro Minute in die Tiefgarage fahren zu lassen. Das macht 300 Autos in der Stunde; für sechshundert Autos braucht man dann tatsächlich zwei Stunden. Das liege nicht nur an der Einfahrt, sondern auch an den für die Praxis völlig untauglichen Abfahrtsrampen. Zwar wolle man versuchen, die Abfahrtsrampen und die der Auffahrten zu wechseln und künftig eventuell den Verkehr andersrum zu leiten, aber ob es wirklich was bringen wird, konnte man mir bei Vinci auch nicht sagen. Falls die Verkehrsabwicklung im Parkhause selbst – das, sagen wir es sofort, über ausreichend Stellplätze verfügt – nicht schneller vonstatten geht, nützt es auch nichts, die beiden Schranken offen zu lassen und einen Beamten daneben zu stellen, der den Fahrern vorgedruckte Parkscheine aushändigt, und dasselbe bei der Ausfahrt zu praktizieren. Meines Erachtens würde das die Sache schon beschleunigen. Bleibt beim Ausfahren immer noch die gefährliche Einfahrt in den Verkehrsfluss auf dem Boulevard Kennedy, die ein weiterer Mangel der Planung ist.
Für den Konzertbesucher bedeutet die aktuelle Situation Stress. Und das ist wohl das Schlimmste, was man ihm zumuten kann. Stress vor dem Konzert: Komme ich zeitig in die Parkgarage und bekomme ich einen Platz, der nach dem Konzert nicht überlanges Warten bei der Ausfahrt mit sich bringt? Bekomme ich eventuell einen Platz außerhalb der Parkgarage, irgendwo in der Gegend der Philharmonie? Und was ist, wenn es regnet? Soll ich den Wagen am Glacis abstellen und zu Fuß gehen? Wiederum: Und wenn es regnet? Nach dem Konzert gibt es wieder Stress. Viele Leute rennen schon während des Beifalls los, um als erste in der Garage zu sein. Macht das Sinn? Gehört das zum Ambiente-Konzept des armen Naske? Der Philharmonie-Intendant wurde jedenfalls von törichten Planern ganz schön hintergangen!
Lösungen? Wer kennt sie? Wer hat sie? Wer setzt sie um? Würde es etwas nützen, die Parkhausgebühr pauschal in die Ticketpreise hineinzurechnen und die Garage ab 18 Uhr für den Konzertbetrieb sperrangelweit zu öffnen?
Ist es vielleicht denkbar, von der Rue du Fort Niedergrünewald aus zusätzliche Einfahrten und Ausfahrten direkt ins dritte und ins vierte Untergeschoss des Parkhauses zu graben? Sind andere, zusätzlich zu schaffende Ein- und Ausfahrten denkbar?
Oder sollte man einen Shuttle-Service zwischen dem Glacis und der Philharmonie einrichten? Als sichtbares Zeichen eines Schildbürgerstreichs?
Schlimmstenfalls, wenn wirklich nichts zu machen ist, gehen wir ganz einfach nicht mehr ins Konzert, stellen einen Chor zusammen und singen alle zusammen ganz laut das Lied von der Bananen-Monarchie! *
* Seither hat es Verbessrungen gegeben, aber ganz gelöst ist das Problem nicht.
- Die Philharmonie wird 20 Jahre alt – und das wird mit Bildern gefeiert
- Es ist genau 20 Jahre her, dass die Philharmonie in Luxemburg eröffnet wurde. Zwanzig Jahre voller Emotionen, Musik, Begegnungen und Kreationen. Um dieses Jubiläum zu feiern, lädt die Philharmonie Luxemburg zur Ausstellung 20 Jahre alt werden… 20 Joer Philharmonie Luxemburg ein, die zwei Jahrzehnte Geschichte anhand von Plakaten, Archiven, Videos und Fotografien nachzeichnet.
- Eine Fotogalerie, eine Videoinstallation, Gästebücher mit Unterschriften der Künstler, die unsere Bühne betreten haben, sowie einige Überraschungen… Diese Ausstellung ist eine Einladung, die Intensität der seit 2005 gemeinsam erlebten Momente erneut zu erleben. Die Ausstellung wurde von Inês Rebelo de Andrade in Zusammenarbeit mit dem Team der Philharmonie konzipiert und gestaltet. Alle Fotos der Ausstellung stammen aus den Archiven der Philharmonie Luxembourg und wurden von unseren Hausfotografen Eric Engel, Sébastien Grébille, Inês Rebelo de Andrade und Alfonso Salgueiro aufgenommen.
- Zu entdecken ab sofort in der Philharmonie Luxembourg und bis November 2025.