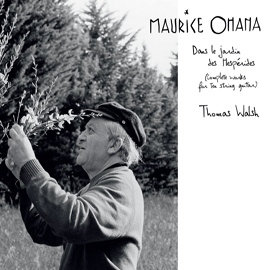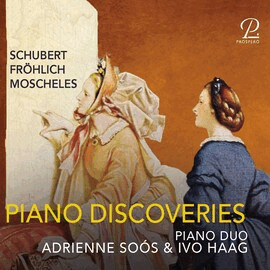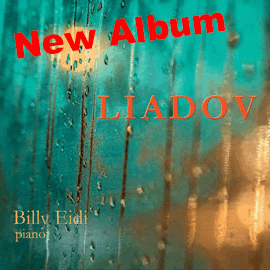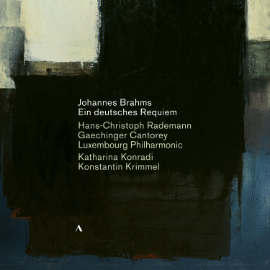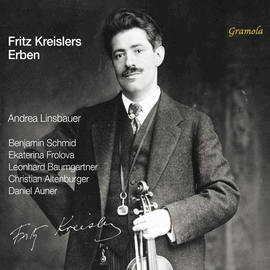Das Gewandhausorchester Leipzig gastierte mit seinem Kapellmeister Andris Nelsons im Großen Musikvereinssaal. Mit dem Geiger Augustin Hadelich hatten sie einen amerikanisch-deutschen Solisten hinzu gebeten. Uwe Krusch hörte für Pizzicato das Programm mit einem Klassiker und einer Rarität auf dem Programmzettel.
Den Abend eröffnete der Klassiker, nämlich das Violinkonzert von Johannes Brahms. Nelsons und das Gewandhausorchester hatten sich eine evolutionär entwickelnde Lesart zurechtgelegt, also keine revolutionäre, die mit Ecken und Sprüngen auffällt. Diese sich aufschwingende Interpretation verband sich aufs Innigste mit dem Spiel von Augustin Hadelich. Auch seine Herangehensweise war von klanglicher Delikatesse geprägt. Dank seiner überragenden Fähigkeiten in der technischen Umsetzung konnte er sich ganz der Gestaltung zuwenden. Dafür blieb er ebenfalls bei einer erzählenden Struktur wärmster Prägung. Damit mochte er sich bei Brahms fühlen, der sein Konzert so angelegt hatte, dass jeglicher solistischen Herrlichkeit im üblichen Sinne eine Absage erteilt wurde.
In einigen Momenten wusste sich das Orchester so selbstbewusst zu präsentieren, so im Dialog des Solisten mit den Holzbläsern etwa, dass es zu dem Eindruck der Einbettung des Solisten Primus inter Pares kam. Er wurde tonlich zwar nicht zugedeckt, aber konnte auch nicht die Klangfreiheit für sich beanspruchen.
Mit einer gefälligen, aber auch packenden Zugabe dankte Hadelich. Mit einer eigenen Bearbeitung für Violine solo ließ er Por una cabeza von Carlos Gardel erklingen.
Im zweiten Teil des Konzerts löste Nelsons, der aktuelle Nachfolger von Artur Nikisch als Kapellmeister beim Gewandhausorchester, dessen Versprechen ein, hatte Nikisch doch 1920 von der positiven Resonanz der ersten vollständigen Aufführung der Sinfonie in fis-Moll op. 41 von Dora Pejacevic in Dresden gehört und ihr eine Aufführung in Leipzig angeboten. Nikisch’ plötzliches Ableben verhinderte dann die Umsetzung. Das Gewandhausorchester und Nelsons boten nun dieses große sinfonische Werk in einer packenden Interpretation an.

Andris Nelsons
(c) Marco Borggreve
Während des Ersten Weltkriegs entstanden und 1920 überarbeitet, überwältigt das Werk geradezu mit seinem spätromantischen Tonfall und der opulenten Orchestrierung. So hat Pejacevic etliche Instrumente zur im engeren Sinne klassischen Besetzung hinzugenommen, etwa groß besetztes schweres Blech inklusive Tuba sowie Piccoloflöte, Englischhorn, Bassklarinette und Kontrafagott bei den Holzbläsern und auch eine Harfe. Die umfangreiche Instrumentierung nutzte die Komponistin gleich im ersten Satz, aber auch später, um dichte klangmächtige Aussagen zu treffen. In diesen Momenten war ein strukturelles Erkennen der Musik schwierig. Ansonsten aber eröffnete ihre Komposition ein erkennbar handwerklich durchgestaltetes Opus, das mit einer großen Zahl musikalischer Einfälle punktete. In einer späteren Lebensphase, wäre ihr eine solche vergönnt gewesen, hätte sie vielleicht einiges stringenter und ökonomischer formuliert. So aber durfte man sich am Füllhorn von Ideen erfreuen, die vor allem in den sparsamer besetzten Passagen ihren großen Reiz versprühten.
Das bestens disponierte und hellwache Orchester folgte Nelsons Dirigat punktgenau, so dass man jederzeit vom fordernden Gestaltungslauf gebannt wurde und das Werk trotz kleinerer handwerklicher Petitessen einfach genussvoll verfolgte. Das Publikum musste sich hier sogar erstmals an diesem Abend mit Bravorufen aus dieser Spannung befreien. Somit hatte der aktuelle Fokus-Künstler im Musikverein, Andris Nelsons, eine spannende Rarität vorgelegt, die man gerne kennenlernte.